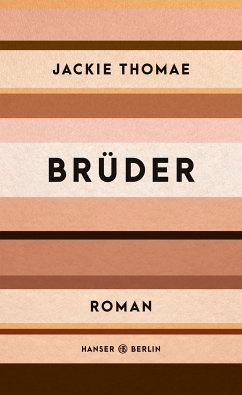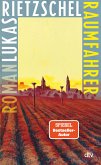Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Zwei Einzelkämpfer, die ihren eigenen Weg gehen. Thomaes \"Brüder\" stehen zu Recht auf der Shortlist des Buchpreises.
© BÜCHERmagazin, Tina Schraml (ts)

Jackie Thomaes "Brüder" ist kein Roman über Hautfarbe, Rassismus, keiner über den Osten, den Westen. Er handelt trotzdem von Identitätspolitik
Es ist noch gar nicht so lange her, als immer wieder gefragt wurde, wann denn nun der "große Wenderoman" erscheine. Ein Roman, der die Zeit der Wiedervereinigung literarisch verhandele, der die deutsch-deutsche Frage zum Thema habe, die der Identitäten und ihrer Brüche, der von den späten achtziger und den neunziger Jahren in Deutschland erzähle. Indem sie sich nach etwas "Großem" sehnten, hatten diejenigen, die nach diesem Roman fragten, immer ein Epos vor Augen, eine große Erzählung, monumental und bedeutungsschwer. Deshalb waren viele so froh, als 2008 endlich "Der Turm" von Uwe Tellkamp erschien und ein paar Jahre später in 180 Minuten Länge auch noch fürs deutsche Fernsehen verfilmt wurde. Es gab Autoren wie Ingo Schulze, Clemens Meyer, Lutz Seiler oder Eugen Ruge. Aber wie Tellkamp seine Geschichte über den Untergang der DDR und die Menschen erzählte, die es im Sozialismus eigentlich gar nicht hätte geben sollen - Bildungsbürger, die sich im gesellschaftlichen Abseits zur dornröschenhaften "Turmgemeinschaft" zusammengefunden hatten -, war einfach pathetischer als alle anderen vor und nach ihm und durfte so auf jeden Fall gleich in die deutsche Literaturgeschichte eingehen.
Das aber ist nun schon eine ganze Weile her. Nach all den Jahren und all den über die deutsche Geschichte schreibenden Männern kommt jetzt Jackie Thomae und macht alles anders. Sie schreibt einen Roman, den sie "Brüder" nennt, ohne damit auch nur im Geringsten das "Alle Menschen werden Brüder" zu meinen, das so gerne als musikalisches Symbol der deutschen Einheit gefeiert wird. Brüder und Schwestern werden bei ihr alle, wenn überhaupt, dann nur in den Technoclubs der neunziger Jahre. Sie erzählt die Geschichte von Mick und Gabriel, die, ohne voneinander zu wissen, beide denselben Vater haben, den sie nicht kennen. Dieser Vater hatte zwischen 1967 und 1970 in der DDR Medizin studiert. Er hatte als "afrikanischer Student aus jungen Nationalstaaten" ein Stipendium bekommen und war nach Abschluss des Studiums zurück nach Senegal gegangen - hatte aber sowohl in Leipzig als auch in Berlin jeweils eine Frau und einen kleinen Sohn hinterlassen.
"Brüder" schildert die völlig unterschiedlich verlaufenden Leben dieser beiden Söhne. Und eigentlich ist alles da, was zu einem Epos gehört: die Geschichte einer Generation und einer Epoche, die Folgen eines politischen Umbruchs, die Fragen nach der Ost- und Westidentität und die nach der Hautfarbe, weil beide Jungen einen schwarzen Vater haben. Genauer betrachtet ist der Roman aber etwas anderes: Er ist ein Epos, das Wert darauf legt, keins zu sein. Eine Art Gegen-Roman zum "Turm". Er verzichtet auf Pathos und zu viel Bedeutung und ersetzt diese durch Ironie, Lakonik, Lust an der Unterhaltung und eine beeindruckende, manchmal fast schlafwandlerisch wirkende Leichtigkeit, mit der die Autorin erzählt. Er setzt keine Denkmäler, sondern Pointen, handelt von einem der aktuellsten Themen, nämlich Identitätspolitik, und sagt zugleich mit jedem Satz: Dies ist kein Roman über Hautfarbe und keiner über Rassismus, keiner über den Osten oder den Westen. Oder, wie es an einer Stelle aus Micks Sicht heißt: "Die Ausländer- und die Ostfrage gleichzeitig, nein danke." Aber was ist er dann?
Mick wächst, so erzählt es Jackie Thomae, als Kind seiner alleinerziehenden Mutter in der DDR auf, geht zum Rudertraining, treibt sich mit seiner Clique im Plänterwald herum, als die Mutter, die einen Ausreiseantrag gestellt hat, ihm verkündet, dass sie heiraten würde, was bedeutet, dass sie vom Treptower Park auf die andere Seite nach Halensee "rübermachen" würden. In der Sechszimmerwohnung des neuen Stiefvaters verbringt er "friedliche Nachmittage mit MTV und Masturbation". Er beginnt eine Ausbildung als Zimmermann, die er selbst "so beiläufig wahrnimmt wie eine flüchtige Diskobekanntschaft". Dann aber fällt die Mauer und die neunziger Jahre beginnen: "Die Stadt", heißt es im Roman, "wurde zum Spielplatz und entwickelte sich nach seinem Geschmack. Die Sonne war herausgekommen. Zeit für Frauen. Zeit für Partys. Zeit für neue Freunde."
"Brüder" sind zu Beginn des Romans in der Mick-Erzählung erst mal Mick und Desmond, den er auf dem Weg in einen Club kennenlernt und mit dem er von nun an gemeinsam unterwegs ist - Desmond, der "dunkler ist als er, etwas kleiner, neun Jahre älter, Amerikaner und somit ausgestattet mit einem natürlich Vorsprung an Coolness. Ein Bruder, ja." Desmond verwickelt Mick und dessen Freundin Delia, eine Jurastudentin aus Hannover, in eine Kokain-Schmuggel-Aktion, für die alle drei nach Kolumbien fliegen, in einer Art Arztpraxis "kleine weiße Bömbchen" schlucken, die aussehen wie Tampons, und diese in einem brandgefährlichen Drama, das Mick und Delia zu Überlebenden macht, in ihren Körpern zurück nach Europa transportieren.
Was von der Aktion übrig bleibt, sind eine ganze Menge "braune Scheine mit den Brüdern Grimm", die Mick, neuerdings Clubbesitzer in Berlin, "brüderlich" mit seinen Freunden teilt, während Delia für beide eine Plattenbauwohnung in Pankow kauft. Indem sie mit Mick in die Berliner Nachtlebenwelt eintaucht, wird Jackie Thomae zur Chronistin einer Stimmung, in der in den neunziger Jahren alle der Jahrtausendwende wie einem "furiosen Finale" entgegenhecheln, "von dem niemand so genau wusste, wie es aussehen würde". Niemals, findet Mick, der Rastlose, der bei den Frauen so ungeheuer gut ankommt, der eigentlich lieber keine Kinder will und irgendwann Yogalehrer wird, "war seine Herkunft egaler als in dieser Zeit".
"Farbe bekennen? Ohne mich", meint, ähnlich wie er, im zweiten Teil von "Brüder" Gabriel, der Halbbruder, von dem Mick nichts weiß. "Und ich sage dir auch, warum: Weil Hautfarbe als Distinktionsmerkmal die Grundlage für jede Art von Rassismus ist. Die Einzigen, die sich daran orientieren dürften, sind bekennende Rassisten. Wenn diese Unterscheidung aber kompletter Unsinn ist, was sie nachgewiesenermaßen auch ist, wieso sollte ich mich nach ihr richten? Wieso sollte ich mich einer Gruppe zuordnen lassen, die gar nicht existiert?"
Jackie Thomae entwirft also eine Versuchsanordnung: Zwei Jungen, geboren in der DDR, die aufwachsen, ohne ihren Vater zu kennen, deren Hautfarbe aber immerzu an diesen Vater erinnert - welchen Weg schlagen sie, die unter so ähnlichen Voraussetzungen ins Leben starten, unabhängig voneinander ein? Die Wege könnten unterschiedlicher nicht sein: Gabriel ist ein ehrgeiziger Kontrollfreak, eher humorlos, aber begabt, der heiratet, Vater wird, Karriere macht und zum Stararchitekten wird, überall in der Welt Bahnhöfe baut, Museen oder Villen, bis zur völligen Erschöpfung. Die Tendenz, aus seiner Herkunft kein Drama, in gewisser Weise sogar noch nicht einmal ein Thema zu machen, die aber hat er mit Mick gemein. "Entschuldige", sagt er an einer Stelle zu einer Freundin, die ihm vorwirft, aus Wut auf seinen abwesenden Vater seine "schwarze Seite" zu verleugnen, "ich laufe nicht den ganzen Tag herum und denke, ich bin schwarz, ich bin schwarz, oh Gott, ich bin schwarz." Mick würde dies ganz ähnlich formulieren.
Und damit ist auch bald klar, worum es bei Jackie Thomae geht. Es sind keine Thesen zu Herkunft oder Rassismus, die die Autorin interessieren, keine politischen Stellungnahmen, weil solche Stellungnahmen immer auch eine Klarheit suggerieren, die sie gerade vermeiden will, das Schematische, das Schwarz und Weiß. Worauf sie ihren Blick richtet, sind individuelle Situationen und die Widersprüche, die sie mit sich bringen. Es ist nicht so, wie wir reflexhaft oft denken. Guckt genau hin, es ist komplizierter, sagt Jackie Thomae und bringt ihre Figuren in Situationen, die die Erwartungen oft unterlaufen.
So zieht Mick mit Delia widerwillig in den Plattenbau nach Pankow, der ausgerechnet die ehemalige Botschaft eines Zwergenstaats ist, und wird mit ihr, wie ihre Diplomatenvormieter, zu einem Paar auf fremden Terrain. Er fühlt sich wie innerhalb einer Stadt ausgewandert. Das Land, das er verlassen hat, existiert nicht mehr, doch in Pankow erscheint es ihm so lebendig, dass er jeden grantigen Rentner für einen verbitterten Parteikader hält. Als er sich gerade mit seiner neuen Wohngegend abgefunden hat, wird er von Typen, die an einer Trinkhalle herumlungern, angepöbelt. Mick hat Kapuze und Kopfhörer auf und beschließt, sie zu ignorieren, als er aus dem Nichts einen Stoß in den Rücken kriegt, während hinten am Kiosk einer die rechte Hand hebt: "Sieg Heil, Nigger." Mick schlägt den Angreifer nieder und erkennt in ihm zu seinem Erstaunen einen Schulkameraden von früher, der sich ein misslungenes Nashorn auf die Gurgel hatte tätowieren lassen, das sich bei genauerem Hinsehen als Karte des Deutschen Reichs herausstellte. Sein Lachen ist das von früher - und so passiert etwas, das man erst gar nicht versteht: Mick beschließt, das Ganze als das zufällige Wiedersehen mit einem Bekannten aus Kindertagen zu verbuchen und nicht als Naziüberfall. Er will wie Gabriel mit den Kategorien von Täter und Opfer, Rechtsradikalen und Ausländern so sehr nichts zu tun haben, dass er mutwillig wegschaut.
Bei Gabriel wiederum steht dort, wo im Roman seine Ich-Erzählung beginnt, die Polizei vor der Tür, weil ihm ein sexueller, rassistisch motivierter Übergriff auf eine seiner - schwarzen - Architekturstudentinnen in London vorgeworfen wird. Dass er selbst schwarz ist, spielt dabei keine Rolle. Etwas überspannt war er morgens vor die Haustür gegangen, wo eine junge Frau gerade einen Hund ausführte, der Gabriels Fahrrad soeben als Baum missbrauchte. Die Hundekacke entdeckte er erst, als er sich über sein Vorderrad beugte - und rastete aus. Er griff in die Scheiße, rannte dem Mädchen hinterher und verteilte den Hundekot schreiend auf der Pelzkapuze ihres Parkas und schließlich auf ihrem Kopf. Dass es seine Studentin war, erkannte er nicht. Sie aber schon. "Mein Mann ist kein Rassist, mein Mann hat einen Burn-out, er ist krank", sagt Gabriels Frau Fleur. Wenig später sitzt der mutmaßliche Rassist auf dem Gesundheitsamt, wo er auf einem Formular ankreuzen soll, welcher ethnischen Gruppe er angehört und verzweifelt: "Es war ein Rassenformular und machte sich nicht die Mühe, das zu kaschieren."
Jackie Thomae wurde 1972 geboren, wuchs in Leipzig bei ihrer Mutter auf, ging nach der Wende nach Berlin, wo sie als Journalistin und Fernsehautorin arbeitete, zwei Sachbücher und ihren ersten Roman, "Momente der Klarheit", schrieb. Erst spät lernte sie - wie die beiden Romanbrüder - ihren Vater kennen, einen Zahnarzt aus Guinea, der völlig überraschend in ihr Leben trat. Und natürlich spielt das Autobiographische in ihren funkelnden, schlauen Roman hinein. Aber eben nur beiläufig, so wie ihre große Erzählung nur beiläufig groß sein will und - auch weil sie souverän so viele Sprachen und Stimmen einfängt, von den siebziger Jahren im Osten über den Sound der Neunziger bis zum Identitätsdiskurs der Gegenwart - doch tatsächlich groß ist.
"Wie gehen Sie selbst mit Rassismus um?" oder "Fühlen Sie sich manchmal diskriminiert?", wurde die Autorin, die auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises steht und eine verdiente Gewinnerin wäre, in den vergangenen Wochen in Interviews gefragt. Sie antwortete höflich. Hat sie nicht gerade auf vierhundert Seiten erzählt, wie kompliziert die Antworten auf solche Fragen sind?
JULIA ENCKE
Jackie Thomae: "Brüder". Roman. Hanser Berlin, 430 Seiten, 23 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Wie kann man nur so genau und cool über Männer schreiben? Über Osten, Hautfarben, Normalität und Chaos? Deutsche Gegenwart, scharfsinnig-leicht." Alexander Cammann, Die Zeit, 21.11.19
"Dass das mit der Hautfarbe und dem Rassismus komplizierter ist, als die Social-Justice-Warrior denken, zeigt dieser beobachtungsstarke Gesellschaftsroman." Ijoma Mangold, Die Zeit, 21.11.19
"'Brüder' ist auf eine angelsächsisch anmutende Art ungemein intelligent, humorvoll und unterhaltsam zugleich geschrieben und bringt damit eine sonst weitgehend fehlende Qualität in die deutsche Literatur ein." Katharina Granzin, Frankfurter Rundschau, 08.10.19
"'Brüder' schildert die völlig unterschiedlich verlaufenden Leben zweier Söhne. Und eigentlich ist alles da, was zu einem Epos gehört: die Geschichte einer Generation und einer Epoche, die Folgen eines politischen Umbruchs, die Fragen nach der Ost- und Westidentität und die nach der Hautfarbe, weil beide Jungen einen schwarzen Vater haben. Genauer betrachtet ist der Roman aber etwas anderes: Er ist ein Epos, das Wert darauf legt, keins zu sein... er verzichtet auf Pathos und zu viel Bedeutung und ersetzt diese durch Ironie, Lakonik, Lust an der Unterhaltung und eine beeindruckende, manchmal fast schlafwandlerisch wirkende Leichtigkeit, mit der die Autorin erzählt. Er setzt keine Denkmäler, sondern Pointen, handelt von einem der aktuellsten Themen, nämlich Identitätspolitik, und sagt zugleich mit jedem Satz: Dies ist kein Roman über Hautfarbe und keiner über Rassismus, keiner über den Osten oder den Westen." Anna Prizkau, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 06.10.19
"'Brüder' weiß ziemlich viel über das Leben und die Welt zu erzählen und kann in wenigen Sätzen Szenen und Figuren anlegen, dass man mit den Ohren schlackert, wie da durch präzise skizzierte finanziell scheiternde Berliner Clubs und Resorts in Thailand und chinesische Großbaustellen galoppiert wird, als wäre es nichts. Und wie da über Hautfarben und deren Zwischentöne geschrieben wird, die mit der Handlung auf den ersten Blick nicht viel zu tun haben, aber an denen niemand so recht vorbeikommt, das hat man in dieser Subtilität zuletzt bei Zadie Smith gelesen." Andrea Diener, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.10.19
"Thomae erzählt leicht und souverän, ein sanftes Allwissen könnte man ihre Technik nennen, denn alles Auktoriale geht in der Empathie auf, mit der sie, oft in erlebter Rede, die Handlung aus der Persektive ihrer Figuren schildert. ... Es gelingt ihr einen tragfährigen epischen Bogen aufzuspannen. Schlüssig und doch im Bewusstsein des unergründlichen Zufalls wird geschildert, wie sich Persönlichkeiten über drei Jahrzehnte hinweg entfalten." Juliane Liebert, Die Zeit, 26.09.19
"Man kann sagen, dass 'Brüder' wirklich eine große deutsche Neuigkeit ist: Ein Roman, der von Herkunft und nicht-weißer Identität erzählt, ohne seine Formen und Fragen von diesem Thema abhängig zu machen." Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung, 17.09.19
"Brüder ist ein perfekt durchdachter, klug konzipierter und eloquent verfasster Gesellschaftsroman, dessen überbordende Leidenschaft und Dynamik zusammen mit Jackie Thomaes Fähigkeit, plastische Figuren zu zeichnen und in deren Psyche vorzudringen, Geist und Sinne schärfen. Ein schillerndes Aushängeschild zeitgenössischer deutscher Literatur." Gérard Otremba, Rolling Stone, 01.09.19
"Ein Plädoyer für den zweiten Blick und auch den dritten, ein Plädoyer gegen die Gefahr, farbfehlgeleitet durch die Welt zu gehen." Tobias Becker, Der Spiegel, 17.08.19