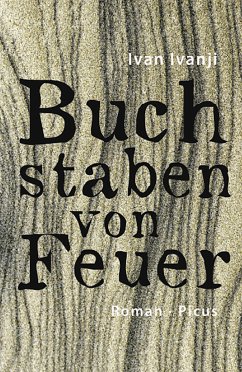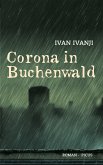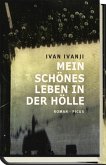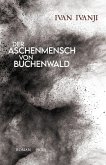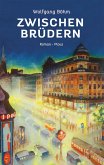Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Tückische Erinnerung: Ivan Ivanjis Roman "Buchstaben von Feuer" erzählt von zwei Männerschicksalen im Zeitalter der Diktatoren
Sechsundsechzig Jahre nach der Befreiung des Lagers Buchenwald ist die Erinnerungskultur des Holocaust so lebendig wie nie zuvor, wenn auch die meisten Zeitzeugen inzwischen gestorben sind. Ivan Ivanji, 1929 im (serbischen) Banat geboren, ist einer der wenigen, die heute noch leben, und er hat den traumatischen, prägenden Jahren seines Lebens in immer neuen Varianten viele eindrucksvolle und böse, auch groteske und verstörende Romane gewidmet - ähnlich wie der fast gleichaltrige Aharon Appelfeld.
Beide verabscheuen jene Erinnerungskultur, die bei Gedenktagen im Lager die einstigen Insassen zu "Touristen und Ehrengästen des eigenen Leidens" macht. Lakonisch notiert Ivanji, der spätere Dolmetscher Titos, der in Belgrad Architektur und Germanistik studierte und 1974 bis 1978 in Bonn jugoslawischer Kulturattaché war, in Buchenwald: "Der Unterschied zwischen dem Direktor und mir ist: ich war als Kind in diesem Lager, er verwaltet es als Gedenkstätte." Sein neuer Roman heißt "Buchstaben von Feuer" und erzählt die abenteuerliche Geschichte der beiden Bauhaus-Studenten Franz und Siegfried, die als Häftlinge den berüchtigten Schriftzug "Jedem das Seine" über dem Lagertor schmieden und später im Strafbataillon 999 in Afrika kämpfen mussten.
Doch sie beginnt im Frühjahr 2010 in Belgrad, auf dem Dach des zerbombten Innenministeriums. Wieder hat ein Krieg Spuren hinterlassen, der dritte in diesem Roman. Und Siegfried Wahrlich, der sich hier als Geist wiederfindet, leitete als deutscher Kriegsgefangener den Bau des pompösen Gebäudes im stalinistischen Zuckerbäckerstil. Von der Seite spricht ihn ein weiterer Geist an, den wir schon aus Ivanjis bitterer Gespenstergeschichte "Der Aschenmensch von Buchenwald" kennen: "Übrigens soll ich dich von Franz grüßen", spricht dieser. "Man hat eine Ausstellung über ihn in Weimar eröffnet. Du stimmst mir doch zu, dass er das verdient hat." Wahrlich weiß nicht, was er sagen soll - immerhin hatte dieser Franz Ehrlich, eine historische Figur, über die der Autor für obige Ausstellung geforscht hat, in der DDR eine sehr obskure Karriere gemacht. Vom Geheimdienstgebäude aus haben die beiden nicht nur einen überwältigenden Blick auf die Stadt und die Flüsse Save und Donau, sondern auch einen desillusionierten auf das taumelnde Jahrhundert, in dem innerhalb von Sekunden aus Freunden erbitterte Feinde wurden und ein Zögern im falschen Moment einen für Jahre ins Zuchthaus brachte.
Neben Neugier und Abenteuerlust treibt die Frage nach den Umwegen und Selbsttäuschungen der Erinnerung Invanjis Roman an, und ähnlich wie in Vladimir Nabokovs "Erinnerung, sprich" ist es vor allem ihr Eigensinn, ihre Respektlosigkeit und Skepsis, die den Schriftsteller faszinieren. Sein Held Siegfried wächst in Weimar in ärmlichen Verhältnissen auf, seine politische Bildung holt er sich in einem Hinterzimmer des "Hotel Elephant" bei pragmatischen Handwerksmeistern und Hilfsköchen, die vom Kieler Matrosenaufstand erzählen. Wie ein Korken schwimmt der Junge auf einem unauslotbaren Meer von Bündnissen, Bekenntnissen und Machtstrategien, und später wird der urgermanisch Aussehende, der aber schüchtern ist und am liebsten zuhört, feststellen: "Es hat mich immer nur hinter sich hergezogen."
Rahel, die er während seiner Lehre am Bauhaus kennenlernt, hält ihn für tapfer - dabei war er meist nur ratlos: Kommunist wurde er, weil er sich verliebt hatte, und im Lager hielt er sich an seinen alten Freund Franz und landete im Widerstand. Psychologisch sehr klarsichtig, zutiefst ambivalent und nicht unsympathisch ist diese Figur gezeichnet, die glaubt, nie genug zu wissen, um in den Lauf der Dinge einzugreifen. Zwar ist Siegfried ein Improvisations- und Planungsgenie, aber schweigsam und verstockt auf Parteiversammlungen. Das reicht, nach dem Krieg zurück in der ideologisch hochgerüsteten DDR, nur für ein sehr bescheidenes Glück.
Auch wenn mancher historische Exkurs verzichtbar gewesen wäre: dieser Durchschnittsmensch, der ehrgeizig, aufgeweckt und praktisch ist und nur mäßig an Politik interessiert, bietet eine ideale Projektionsfläche für den Wahnsinn, der - immer aufs Neue - bieder und alltäglich anfängt und in monströsem Grauen endet. Die schonungslosen Dialoge, die Alltagserfahrungen im Lager und die Verhörszenen bis in die Tito-Zeit, die unübersehbar von den eigenen Erfahrungen des Autors erzählen, lesen sich eindrucksvoll. Und die Aufgabe der beiden Geister auf dem Dach des Geheimdienstes ist angesichts der Tonnen vernichteter Dossiers eindeutig: Sie wollen mit ihren bohrenden Fragen den Lebenden jegliche Distanz austreiben, die wohlmeinende so gut wie die ängstliche oder berechnende. Dabei kommt es "auf eine Niederlage mehr oder weniger auch nicht mehr an". Nur aufgeben, das geht nicht.
NICOLE HENNEBERG
Ivan Ivanji: "Buchstaben von Feuer". Roman.
Picus Verlag, Wien 2011. 216 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH