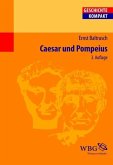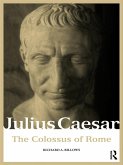Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Mischa Meier vermisst die Handlungsspielräume von Gaius Iulius Caesar
Viel schwerer als die selbstgesetzte Aufgabe, Gallien zu erobern und anschließend die eigene Ausnahmestellung in Rom durch einen reichsweiten Bürgerkrieg zu etablieren, lagen Julius Caesar die Lasten auf den Schultern, welche die Nachwelt ihm aufbürdete. Geschäftsführer des Weltgeistes soll er gewesen sein, der "ganze und vollständige Mann", der Volkswillen und Monarchie glücklich vereinte. Oder ein Staatsmann, mithin ein gestaltendes Genie in der außerdichterischen, der realen Welt. Man wollte den Krieger in ihm sehen oder den Totengräber einer Republik, eine tragische Gestalt mit Macht in den Verhältnissen, aber nicht über diese, schließlich das Produkt seiner Risikoentscheidungen.
In das Räsonieren über Caesar Neues einzubringen, das nicht den Stempel des Abseitig-Gesuchten auf der Stirn trägt, erscheint unmöglich. Dem Tübinger Althistoriker Mischa Meier ist ebendies gelungen, vielleicht gerade weil er bislang nicht mit Arbeiten zur Römischen Republik hervorgetreten ist. Als Historiker der Kaiserzeit und Spätantike betrachtet Meier die Monarchie als Normalfall, andere politische Ordnungen bedürfen seiner Ansicht nach hingegen der Erklärung. Folgerichtig denkt er Caesar von der Kaiserzeit her und entwickelt die These, der Handlungsrahmen, in dem Caesar und seine Zeitgenossen agierten, sei letztlich bereits ein monarchischer gewesen, während ihr Bewusstsein und der herrschende Diskurs dem Stand der Entwicklung hinterherhinkten. Die Monarchie bestimmte schon das Handeln, doch die Köpfe waren noch nicht so weit. Das ist nun keine ganz neue Erkenntnis. Sie steckt bereits in Christian Meiers Formel von der Krise ohne Alternative: Die alte Ordnung funktionierte nicht mehr, aber eine andere blieb undenkbar. Und indem Augustus für seinen Bau des "Prinzipats" auf Elemente, Formeln und Traditionen der Republik zurückgriff, obwohl deren politische Träger ausgelöscht waren, bestätigte er ihre Richtigkeit.
Meier möchte mit seiner These einer Inkongruenz von Handlungsrahmen und Diskurs besser erklären, warum ausgerechnet die ausdrücklich unter republikanischen Vorzeichen erfolgte Tötung des ersten Monarchen in Rom letztlich zur Etablierung einer dann bemerkenswert stabilen Monarchie führte. In der Tat kann er einige schwierige Probleme der Caesarforschung auf diese Weise einer Lösung näher bringen. So hatte Caesar in seiner faktischen Stellung als Alleinherrscher keine andere Wahl, als besiegte Gegner zu begnadigen, die meisten ihm angetragenen Ehrungen anzunehmen, andere abzulehnen oder die Ämter für die Zeit seines geplanten Ostfeldzuges auf Jahre im Voraus zu vergeben - gleichzeitig wurde ihm all dies als "tyrannisches" Verhalten angekreidet. Das erklärt auch, warum er sowohl in Sachen clementia als auch beim Königstitel den Ball so flach wie möglich zu halten suchte. Alle seine Versuche, Handlungs- und Diskursebene zur Deckung zu bringen, scheiterten letztlich; was er tat, konnte er nicht begründen oder erklären, nur durchsetzen.
Handlungsrahmen und Diskurs klafften nun, wie Meier mit Recht betont, vor allem aus der Sicht der bis dahin herrschenden republikanischen Elite auseinander; die Soldaten, die stadtrömische Plebs und die geschundenen Bewohner der Provinzen waren längst bereit, dem Befehl eines einzigen Mannes zu gehorchen, wenn dieser ein guter war.
Der entscheidende Einwand gegen Meiers ingeniöse These ist freilich nicht zu Caesars Lebzeiten zu suchen. Für diese ist sein Befund unabweisbar: Caesar agierte höchst konsequent und umsichtig zugleich, ließ diese Tugenden jedoch auf der Diskursebene vermissen. Interessanter sind die Monate nach den Iden des März: In ihnen deutet wenig darauf hin, in der politischen Ordnung Roms schon eine fertige Monarchie zu sehen, die nur auf ihr Alphatier wartete. Antonius war es jedenfalls nicht. Erst der ganz unerwartbare Auftritt von Caesars Adoptivsohn und die vielen, jeweils höchst kontingenten Ereignisse ab dem Sommer 44 vor Christus formierten die Dinge zu einer Polarisierung, die zunächst in den Bürgerkrieg, dann in die Alleinherrschaft führte. Doch auch der Zerfall blieb lange möglich.
Selbst Meier muss an einer Stelle zur doppelt verräterischen Formulierung eines "in Richtung einer Monarchie sich transformierenden Handlungsrahmens" Zuflucht nehmen. Seine luzide geschriebene Erörterung führt letztlich auf die Frage, ob die Römische Republik nicht eine historische Anomalie darstellte - freilich eine mit sehr langen Schatten.
UWE WALTER
Mischa Meier: "Caesar und das Problem der Monarchie in Rom". Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014. 83 S., br., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH