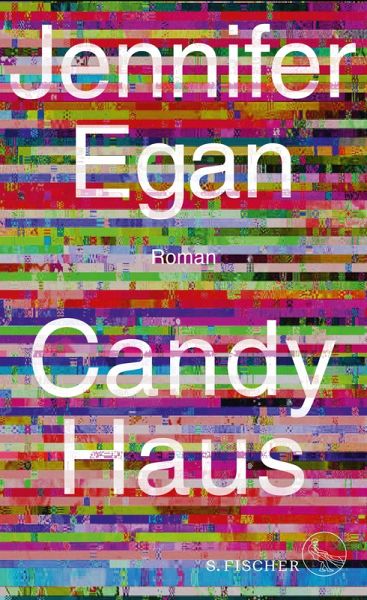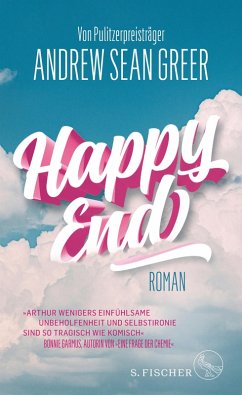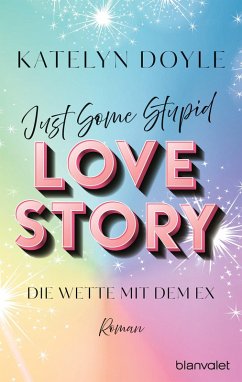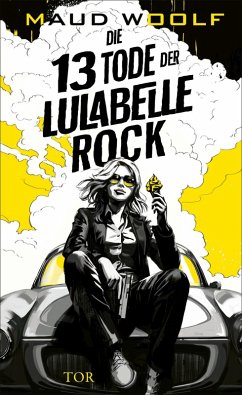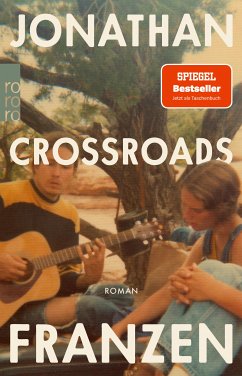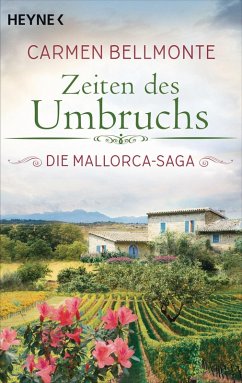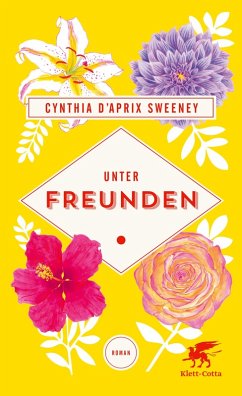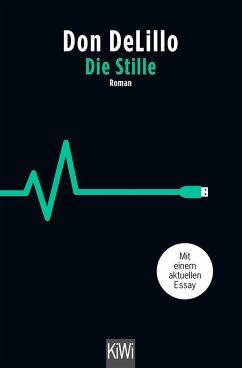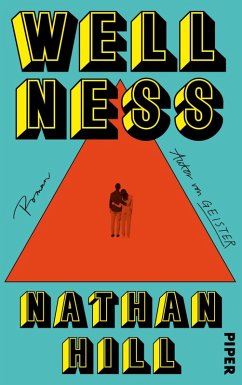Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Mit ihrem Roman »Der größere Teil der Welt« gelang Jennifer Egan der internationale Durchbruch. Jetzt knüpft sie in ihrem neuen visionären Roman »Candy Haus« über unsere Gegenwart ein schillerndes Netz aus Lebensläufen. Im Mittelpunkt steht der charismatische Bix Bouton, Gründer eines atemberaubenden Start-ups in Amerika. Sein Coup ist eine App, die unsere Erinnerungen ins Netz hochlädt. Ein gefährliches Glück, denn die Erinnerungen werden für andere sichtbar. Und da ist Bennie Salazar, Ex-Punk-Rocker, der als Musikproduzent in Luxus driftet und seinen Sohn an die Sucht verliert...
Mit ihrem Roman »Der größere Teil der Welt« gelang Jennifer Egan der internationale Durchbruch. Jetzt knüpft sie in ihrem neuen visionären Roman »Candy Haus« über unsere Gegenwart ein schillerndes Netz aus Lebensläufen. Im Mittelpunkt steht der charismatische Bix Bouton, Gründer eines atemberaubenden Start-ups in Amerika. Sein Coup ist eine App, die unsere Erinnerungen ins Netz hochlädt. Ein gefährliches Glück, denn die Erinnerungen werden für andere sichtbar. Und da ist Bennie Salazar, Ex-Punk-Rocker, der als Musikproduzent in Luxus driftet und seinen Sohn an die Sucht verliert ... New York, Chicago, Los Angeles - die Wüste, der Regenwald: Mit vor Energie funkelnden Figuren erzählt Egan von der Suche nach Familie und Geborgenheit in einer Zeit, in der die digitale Welt unsere Sehnsüchte auffrisst.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 6.98MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
Jennifer Egan wurde 1962 in Chicago geboren und wuchs in San Francisco auf. Sie lebt heute mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Brooklyn, New York. Neben ihren Romanen und Kurzgeschichten schreibt sie für den »New Yorker« sowie das »New York Times Magazine« und lehrt an der Columbia University Creative Writing. Für ihren Roman »Der größere Teil der Welt« erhielt sie 2011 den Pulitzer Prize, den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize. Zuletzt erschien ihr Roman »Manhattan Beach« (2017), der wochenlang auf der »New York Times«-Bestsellerliste stand. Henning Ahrens, geboren 1964, lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Frankfurt am Main. Er veröffentlichte diverse Lyrikbände sowie die Romane »Lauf Jäger lauf«, »Langsamer Walzer«, »Tiertage« und »Glantz und Gloria«. Für S. Fischer übersetzte er Romane von Richard Powers, Kevin Powers, Khaled Hosseini. Zuletzt erschienen sein Romane »Mitgift« und »Jahre zwischen Hund und Wolf«.
Produktdetails
- Verlag: FISCHER E-Books
- Seitenzahl: 416
- Erscheinungstermin: 7. September 2022
- Deutsch
- ISBN-13: 9783104915852
- Artikelnr.: 63768534
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Tobias Döring hat erneut Spaß mit Jennifer Egans verschachtelter Erzählweise, die er bereits aus ihrem Vorgänger- und Pulitzerpreisträgerroman kennt. Dieses Mal geht es um ein Tech-Unternehmen in der nahen Zukunft, dessen neueste Erfindung es Menschen erlaubt, in einer Art "Cloud" ihr Bewusstsein hochzuladen und auf das anderer zuzugreifen. Wie Egan davon erzählt, nämlich in Form einzelner, ganz verschiedener und chronologisch ungeordneter Erzählabschnitte, die sich der Leser zusammenpuzzeln muss, bietet zum einen einen großen Such- und Ratespaß, meint der Kritiker. Zum anderen sieht er in diesem Verfahren auch eine Reflexion auf das Erzählen selbst - als eine Art Sortierung von Datenmassen, um die es im Roman ja auch geht. Ein "raffiniert verschlungenes Erzählgehäuse", das von Henning Ahrens bis auf einen kleinen Ausrutscher hervorragend übersetzt worden sei, lobt Döring.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Das ist so ein Roman, wo ich vor Freude in die Hände klatsche, weil der so klug, so schlau ist. Denis Scheck WDR2 20230108
Was für ein Buch!
So, nachdem ich das Buch jetzt 1 ½ mal durchgelesen habe, habe ich mich dazu entschlossen, dies hier zu beenden und meine Rezi zu schreiben. Danach werde ich das Candy Haus erst einmal beiseite legen. Ganz ehrlich, nach dem ersten Durchgang hatte ich tausend …
Mehr
Was für ein Buch!
So, nachdem ich das Buch jetzt 1 ½ mal durchgelesen habe, habe ich mich dazu entschlossen, dies hier zu beenden und meine Rezi zu schreiben. Danach werde ich das Candy Haus erst einmal beiseite legen. Ganz ehrlich, nach dem ersten Durchgang hatte ich tausend Fragezeichen im Gesicht. Mir rauchte der Kopf, so viele Protagonisten, so viele quasi Kurzgeschichten in einem Roman zusammengefasst, so viele Zeitsprünge und vor allem so viele Verbindungen zwischen den einzelnen Protagonisten, ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Also habe ich einen zweiten Anlauf gestartet mit einer Kladde neben dem Buch. Dann wurde es etwas klarer für mich und trotzdem entsprach es einem kleinen eigenen Universum, vernetzt, wie es nun mal in den sozialen Medien so zugeht und worum es im Candy Haus ja auch geht. Von dieser Perspektive aus gesehen, ist es ein echtes Highlight. Der Leser muss sich aber bewusst sein, dass es eine Herausforderung wird.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein vibrierendes Zukunftsrauschen – außergewöhnlich & tiefgreifend
"Roxy spürt eine Vibration in ihrem tiefsten Inneren, während sich ihr Bewusstsein in das Internet ergießt: ein Sturzbach von Erinnerungen und Augenblicken, manche schmerzhaft – …
Mehr
Ein vibrierendes Zukunftsrauschen – außergewöhnlich & tiefgreifend
"Roxy spürt eine Vibration in ihrem tiefsten Inneren, während sich ihr Bewusstsein in das Internet ergießt: ein Sturzbach von Erinnerungen und Augenblicken, manche schmerzhaft – teils auch Erinnerungen an echten Schmerz –, in einen Kosmos strudelnd, der sich windet und schlängelt wie eine unaufhörlich sich ausdehnende Galaxie." (S. 206)
"Candy Haus" ist visionär und spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der der technologische Fortschritt die Bedeutsamkeit des Individuums, der Privatsphäre und der Beziehungen gewaltig ins Wanken bringt.
"In einem vor Energie funkelnden Roman erzählt Egan von unserer Suche nach Authentizität und Einmaligkeit."
Worum geht's? Der Social-Media-Mogul "Bix" hat ein Produkt namens "Besitze dein Unbewusstes" entwickelt, das es dir ermöglicht, deinen Geist zu externalisieren und deine Vergangenheit zu besuchen, wann immer du willst. Das dort eingebundene "kollektive Bewusstsein" ermöglicht es allen Personen Zugriff auf anonyme Gedanken und Erinnerungen aller lebenden und toten Menschen auf der Welt zu bekommen, die dasselbe getan haben: sein externalisiertes Gedächtnis in ein Online-'Kollektiv' hochgeladen.
Was war das? Bis zur Mitte des Buches habe ich so viele besondere Textstellen markiert. Es hat mich wirklich mitgerissen. Ich war fasziniert vom Schreibstil, doch ab Seite 207 von 415 wurde es abstrus. Es lag nicht nur daran, dass weiterhin jedes einzelne Kapitel in einem komplett anderen Schreibstil, über einen weiteren Protagonisten und in einer anderen Zeit geschrieben wurde. Die Storyline springt in der Zeit herum wie ein Ping Pong, rast zwischen verschiedenen Generationen umher und das hat mich ganz schön verwirrt.
Die schiere Anzahl der auftretenden Charaktere und die vielen Perspektivsprünge machten es mir beinah unmöglich, tiefer in die jeweilige Person und in das Buch abzutauchen.
Am liebsten hätte ich während des Lesens Halt auf einer Charakterkarte gesucht, um das kaleidoskopartige Protagonisten-Potpourri (von Geschwistern, Cousins, Tennispartnern und Drogendealern) vollumfänglich zu erfassen.
Neben der Idee an sich, fand ich insbesondere die Beschreibungen äußerst bemerkenswert: "Die Sonne stand tief, das Licht war rosig, die karge Flora schimmerte in einem matten Silberton. Die Leere der Wüste kam mir biblisch vor, als hätte sich hier nie etwas getan – als stünde die ganze Geschichte noch bevor." (S. 87)
Auch wenn mich einige Teile des Buches verwirrt und ermüdet haben, ist "Candy Haus" ein einzigartiges, komplexes Werk, das mich zum Reflektieren angeregt hat: Wann haben wir das letzte Mal einen ganzen Tag ohne unsere Smartphones verbracht? Sind wir noch immer aufgeregt auf Abenteuer im wahren Leben oder sind wir nur auf der Suche nach dem nächsten Dopaminkick im Internet?
Insgesamt hat mich "Candy Haus" vor allem dadurch überzeugt, dass es wirklich mal etwas ganz anderes war. Ein vibrierendes Zukunftsrauschen, außergewöhnlich und tiefgreifend – ein Buch, bei dem die sprachliche Intensität zelebriert und der brisante Inhalt diskutiert werden sollte.
"»Das Internet beunruhigt mich.«
»Du meinst die allwissende, alles sehende Wesenheit, die, obwohl wir uns einbilden, selbst zu entscheiden, unser Handeln vorhersagt und kontrolliert?«" (S. 27)
3,7 ▷ ⭐⭐⭐⭐
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Unsere Erde in sehr naher Zukunft. Und wenn ich sehr nah sage, meine ich sehr nah, wir sprechen hier von in zwei bis zehn Jahren. Bix Boutons Ruhm baut sich auf einer technischen Erfindung auf. Dank seiner können Menschen jetzt den gesamten Inhalt ihres Gedächtnisses in einen externen …
Mehr
Unsere Erde in sehr naher Zukunft. Und wenn ich sehr nah sage, meine ich sehr nah, wir sprechen hier von in zwei bis zehn Jahren. Bix Boutons Ruhm baut sich auf einer technischen Erfindung auf. Dank seiner können Menschen jetzt den gesamten Inhalt ihres Gedächtnisses in einen externen Speicher herunterladen, der dann allen anderen zur Verfügung steht. Allen anderen, die ebenfalls bereit sind, ihre Erinnerungen, Gedanken und Gefühle mit der Allgemeinheit zu teilen… Was erst für praktische Zwecke, wie das Aufklären von Kriminalfällen und Hilfe für Demenzerkrankte, gedacht war, wird schnell zum viralen Trend. Gleichzeitig erobern weitere Entwicklungen den Markt. Das Hinauszögern der Entdeckung einer verschwundenen Person, indem man sie durch einen Proxy ersetzt. Die daraus entstehende Sparte von darauf Spezialisierten, genau diese Proxys auffliegen zu lassen. Elektronische Asseln, die im Kopf implantiert werden, und damit Zuschauern erlauben, live bei den eigenen Erlebnissen dabei zu sein. Chips, Knöpfe, Kameras… Das Repertoire an Gadgets, die dem Körper hinzugefügt werden können, scheint unerschöpflich. Die mentale Stärke des Menschen ist es nicht...
Nach dieser Beschreibung würde man sich unter „Candy Haus“ von Jennifer Egan wohl einen dystopischen Roman vorstellen, aber ich habe ihn nicht wirklich als solchen empfunden. Dazu war das Thema nicht präsent genug, standen menschliche Beziehungen und Psyche zu sehr im Vordergrund. Ich habe mich des Öfteren gefragt, ob gerade das ein geschickter Schachzug der Autorin ist. Ob sich darin spiegelt, wie schleichend die Technik in unser Leben eindringt und alles übernimmt. Mit welcher Selbstverständlichkeit wir uns ihr anpassen. Aber letztendlich fand ich die ganze Konstruktion zu schwammig. Ich hätte mir hier mehr Handfestigkeit und Fokussierung gewünscht.
Auch ob der Begriff „Roman“ hier greift, kann man diskutieren. Ich würde es eher als eine Sammlung geschickt verflochtener Erzählungen beschreiben. Egan wechselt konsequent die Erzählperspektive, als Leser erfahren wir oft erst spät im Kapitel, bei wem wir uns gerade befinden. Klingt kompliziert, aber für mich war das der größte Teil des Vergnügens, wie ein kleiner Detektiv meine Puzzleteile zu sammeln und in das große Personennetz einzufügen. Jedenfalls den größten Teil des Buches. Irgendwann hat mich die Komplexität überfordert und ist in Sättigung umgeschlagen. Hier wäre weniger vielleicht besser gewesen (das gilt besonders für das letzte Kapitel, liebe Frau Egan. Das vorletzte wäre ein wunderbarer Abschluss gewesen, warum nur haben Sie das zerstört? Zu viele Ideen, die unbedingt untergebracht werden mussten?).
Wer sich fragt, ob man, um „Candy Haus“ verstehen zu können, „Der größere Teil der Welt“ gelesen haben muss: nein, muss man nicht. „Candy Haus“ ist keine Fortsetzung, sondern, wie die Autorin es beschreibt, ein „companion book“. Meines Wissens finden einige Personen in beiden Werken Erwähnung, aber ansonsten stehen sie völlig für sich.
Im Endeffekt befürchte ich, dass „Candy Haus“ in meinen Erinnerungen den gleichen Weg gehen wird, wie „Der größere Teil der Welt“ (Pulitzer-Preis 2011), den Weg ins Schnelle Vergessen. Der Roman ist ohne Frage gut geschrieben, die Themen sind interessant, die Figuren charakterstark, aber dem ganzen mangelt es an einer Struktur, an der man sich festhalten kann. Es hat mir Spaß gemacht, ihn zu lesen, aber am Ende überwiegt bei mir das Gefühl, nichts in den Händen zu halten. Das ist bedauerlich, weil das Potenzial eindeutig vorhanden war.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für