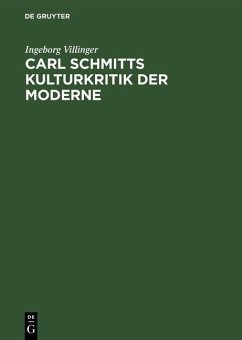Der junge Gerichtsreferendar Carl Schmitt veröffentlichte im Jahre 1913 unter
dem Pseudonym "Johannes Negelinus" in einem Straßburger Verlag die "Schattenrisse". Sie enthalten zwölf Kurzportraits, die in teilweise ironisch-polemischer Zuspitzung, meist aber in absichtsvoll banaler Wiedergabe mit Literatur, Wissenschaft und Politik der Jahrhundertwende ins Gericht gehen. Die im "Börsenblatt des deutschen Buchhandels" als Reiselektüre empfohlene, jedoch bis heute nahezu unbeachtet gebliebene Schrift existiert nur in wenigen Exemplaren und wird mit dem vorliegenden Band wieder zugänglich gemacht. Der vollständige Text der Erstausgabe der "Schattenrisse" wird hier zeilengenau wiedergegeben.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Auf belletristischem Gebiete: Die "Schattenrisse" des Johannes Negelinus von Carl Schmitt
Den 1913 erschienenen "Schattenrissen" des Johannes Negelinus ist es bis heute nicht gelungen, Gemeingut aller Gebildeten zu werden. Im Gegenteil, noch die neueste Auflage von Armin Mohlers Handbuch zur "Konservativen Revolution" verzeichnet das Werk als eine "bibliophile Rarität". Dabei hatte doch dessen Verfasser auf jeder dritten oder vierten Seite seines Opus hervorgehoben, es sei dessen wesentliche und zentrale Bestimmung, möglichst rasch zum Gemeingut aller Gebildeten aufzusteigen.
Das freilich war in Wahrheit der running gag eines Autors, der mit Hohn auf die Bildungskonzepte seiner Zeit blickte. Wer sein Buch in einem fingierten Skiamacheten-Verlag - eine Anspielung auf Platons "Politeia"? - erscheinen ließ, ihm das Motto "Der Schatten ist lebendig" von Dr. Mises - ein Pseudonym von Gustav Theodor Fechner - voranstellte und sich selbst unter dem nom de guerre Johannes Negelinus verbarg, der setzte schon einen verteufelt gebildeten Leser voraus. Magister Negelinus hieß einer der fiktiven Verfasser der "Dunkelmännerbriefe" (1515), der berühmten humanistischen Satire auf spätscholastische Borniertheit. Derjenige aber, der sich dieses Pseudonyms bediente, war kein anderer als der schwarze Mann des deutschen Staatsrechts im 20. Jahrhundert: Carl Schmitt, damals Referendar und 25 Jahre alt.
Die literarischen Neigungen des jungen Carl Schmitt sind bekannt. Nur der Intervention eines realitätssüchtigen Onkels war es zu verdanken, daß Schmitt von seinem Wunsch, Philologie zu studieren, abgebracht und auf die Jurisprudenz gelenkt werden konnte. Wir geben einer späteren Konjekturalhistorie die Klärung der faszinierenden Frage anheim, wie anders die Fachgeschichte der Germanistik, wie anders aber auch die deutsche Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts verlaufen wäre, wenn es diesen Onkel nicht gegeben hätte. Allerdings hat Schmitt auch als Jurist nicht darauf verzichtet, über den theoretischen Status der Fiktion nachzudenken.
Die "Schattenrisse" entstanden in einer Zeit, als Schmitt, der schon in seinen Straßburger Semestern Beziehungen zu expressionistischen Autoren wie Ernst Stadler und René Schickele unterhielt, ganz im Banne Theodor Däublers stand, den er bis an sein Lebensende für den größten deutschen Dichter der Moderne gehalten hat. Seine 1916 erschienenen Studien über Däublers "Nordlicht"-Epos, diesen 30000 Verse umfassenden Entwurf eines Weltmythos, besitzen Schlüsselcharakter für das Verständnis des jungen Carl Schmitt; am Gegenbild dieser wunderlich-gewaltigen kosmogonisch-gnostischen Phantasmagorie, damals von Schmitt noch christlich gedeutet, entfaltete er seine Zeitkritik. Die drei Jahre zuvor entstandenen "Schattenrisse" verhalten sich zu den "Nordlicht"-Studien wie der Schatten zum Licht; sie sind das satirische Abbild jener Zeit und Kultur, von der sich Däublers weltenschaffende Phantasie abgewandt hatte.
Tatsächlich liest sich Schmitts im Geist einer konservativen Avantgarde entworfene Satire auf die spätwilhelminische Kultur durchaus vergnüglich, zumal Schmitt den sprachlichen Bombast, die Phrasen und Floskeln seiner Zeit virtuos zu imitieren wußte. Die "Kräfte", "Wollungen" und "Leitsterne aller Kultur", die Johannes Negelinus "zum Wohle und Gedeihen allseitiger Geistesfrische, harmonischer Persönlichkeitsdurchbildung und moderner Kultur" in seinem Büchlein zusammenstellte, ergeben ein Pandämonium all dessen, was der Katholik Carl Schmitt an seiner Zeit verabscheute: Naturalismus, Positivismus und Monismus, die Verabsolutierung der Naturwissenschaften, Persönlichkeitskult und Idolatrie des Übermenschen, Fortschrittsdenken und eine Bildungsverflachung, wie sie für Schmitt exemplarisch Herbert Eulenbergs eminent erfolgreiche "Schattenbilder" praktizierten: "Den seltnen Reim auf Beulenzwerg / Gewährt uns Herbert Eulenberg."
Als Repräsentanten dieser Tendenzen seiner Zeit stellen die "Schattenrisse" unter anderem Wilhelm Ostwald, Walther Rathenau, Karl Lamprecht, Elisabeth Förster-Nietzsche, Richard Dehmel, Wilhelm Schäfer, Thomas Mann und Fritz Mauthner vor. Im Schattenriß "Pipin der Kleine" redet Schmitt/Negelinus einmal kulturkonservativen Klartext, und das klingt dann freilich auch nicht anders, als spräche ein wilhelminischer Oberlehrer: Es sei eine Tendenz seiner Zeit, "das Kleine hinauf, das Große hinab auf ein zulässiges Erreichbares zu ziehen". Kulturkritische Impulse, der Hochmut eines intellektuellen Dandys gegenüber der misera plebs, die sich mit geistigen Surrogaten zufriedengibt, und das reine Vergnügen an Sprachwitz und Blödsinn sind in den "Schattenrissen" eine merkwürdige Mischung eingegangen. "Dada avant-la-lettre" hat Schmitt später das Büchlein genannt, aber das trifft die Sache nur ungenau.
Ingeborg Villinger hat die "Schattenrisse" in einer staunenswert gründlichen Edition wieder zugänglich gemacht: 260 Seiten Kommentar und Analyse zu 60 Seiten Text! Wer sich zu solchen Proportionen entschließt, wertet bereits damit ein Nebenwerk zu einem Hauptwerk auf, denn so viel Editorenfleiß ist bisher noch keiner Schrift Carl Schmitts zuteil geworden. Tatsächlich versucht Villinger im Anschluß an den gründlichen Kommentar, der den historischen Anspielungsreichtum des Textes auf vorbildliche Weise erschließt, mit einer großangelegten Textanalyse die "Schattenrisse" in den Rang eines "Schlüsseltexts" (so der Klappentext) für das Verständnis von Schmitts Werk zu erheben. Staunend liest man Villingers Diagnose, Schmitt habe "hier die Gegenwart seiner Zeit in all ihren Facetten" ausgeleuchtet, so daß sich die Analyse der "Schattenrisse" als "historisch-kritische Bestandsaufnahme der konkreten Ausgangslage von Carl Schmitt" verstehen dürfe. Mehr noch: Schmitts "staatsrechtlichen und rechtsphilosophischen Abhandlungen" vom "Wert des Staates" (1914) bis zu "Römischer Katholizismus und politische Form" (1923) sollen als "Antwort" auf die in den "Schattenrissen" gegebene "kulturelle Zeitdiagnose" gelesen werden.
Damit wird der kleine Text denn doch überfrachtet - zumal Villinger bewußt darauf verzichtet, über den ästhetischen Status der "Schattenrisse" Rechenschaft abzulegen, und überdies all jene Stellen, die nach Schmitts eigener Aussage nur "ein Spaß" waren, "als nicht kommentierfähig unbearbeitet" läßt. So aber werden die "Schattenrisse" ungewollt zu einem Zitatensteinbruch. Deshalb findet in Villingers höchst ernsthafter Analyse der immerhin doch recht heiteren "Schattenrisse" konkrete Textinterpretation auch nur sehr selten statt; vielmehr werden seitenlang die Theorien und Programme von Pannwitz und Schäfer, Mauthner und Rathenau referiert, um ihnen anschließend ebenso breit die theoretischen Positionen von Schmitt zu konfrontieren, wobei Villinger unbekümmert in dessen Werk hin und her springt. Da wird zum Beispiel - freilich ein Extremfall! - aus der 1934 im Kontext der NS-Ideologie entstandenen Schrift "Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches. Der Sieg des Bürgers über den Soldaten" zitiert und gleich der Satz angeschlossen: "Diese späte Feststellung kündigt der Schattenriß ,Gottfried von Bouillon' bereits im Jahre 1913 an." - Als Panorama der zeit- und kulturkritischen Motive im Frühwerk Schmitts ist also Villingers Studie von großem Nutzen, als Textinterpretation vermag sie nicht zu überzeugen.
Sie habe sich, so die Verfasserin, "trotz der Umstrittenheit des Schmittschen Werkes absichtsvoll einer wertenden Aussage" in ihren Analysen enthalten. Tatsächlich wird der Leser in ihrem Buch vergeblich ein kritisches Wort über Schmitt suchen. Dafür bescheinigt sie seinen Charakteristiken gerne, sie seien "lucide"; so heißt es zum Beispiel auf Seite 138 gleich zweimal über den Schattenriß zu Thomas Mann, hier sei dessen Verfahren der "doppelten Optik" "außerordentlich lucide" beziehungsweise "sehr lucide" beschrieben worden. Dabei ist gerade dieser Schattenriß ein besonders trauriges Beispiel dafür, daß eine Satire das Niveau ihres Gegenstandes nicht erreicht. Wer sich zu dem Reim versteigt: "T. Mann bezeichnet eine Niete / auf belletristischem Gebiete", der bekennt sich im übrigen dankenswert offen zu seinem Ressentiment; Schmitt hat es im Falle Thomas Manns zeitlebens nicht abgelegt.
Es bleibt die Frage nach Schmitts Verhältnis zu den Autoren seiner Zeit, die er nicht in die "Schattenrisse" aufgenommen hat: etwa zu George, Rilke oder Hofmannsthal. Eine gründliche Studie über Schmitts Verhältnis zur literarischen Kultur der Moderne, nicht zuletzt auf der Basis des Nachlasses, bleibt ein Desiderat der Forschung. Ingeborg Villingers Studie hat immerhin wichtige Bausteine hierzu geliefert. Im übrigen wagen wir die Prognose, daß es den "Schattenrissen" auch in Zukunft nicht gelingen wird, Gemeingut aller Gebildeten zu werden. ERNST OSTERKAMP
Ingeborg Villinger: "Carl Schmitts Kulturkritik der Moderne". Text, Kommentar und Analyse der "Schattenrisse" des Johannes Negelinus. Akademie Verlag, Berlin 1995. 361 S., geb., 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main