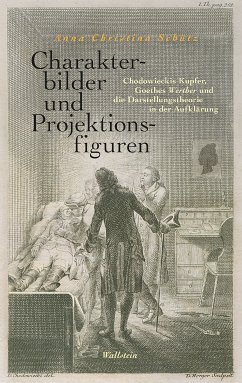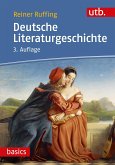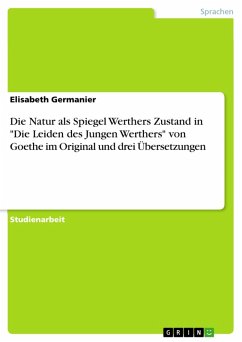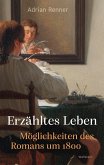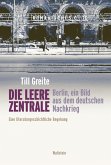Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Chodowieckis Kupfer zu Goethes Kultbuch
Kurz nach dem Tod von Daniel Chodowiecki (1726 bis 1801) ruft der Dichter Gleim im "Göttinger Musenalmanach" dem berühmtesten Illustrator der Goethezeit nach: "Chodowiecki war! / War! Wär' er nicht gewesen / So blieb wohl eine Schar / Von unsern Büchern ungelesen!" Tatsächlich galt der Berliner Zeichner und Kupferstecher als Institution in seiner Zeit. Unter den 2000 Radierungen, die Jens-Heiner Bauer verzeichnete, finden sich auch Illustrationen zu zahlreichen Gedichten, Romanen und Dramen von Lessing bis Schiller. Gleims Einschätzung, dass solche Blättchen den Absatz von Büchern entscheidend förderten, ist sicher zutreffend. Chodowieckis Nachfolger Johann Heinrich Ramberg, der Almanache und Taschenbücher mit kolorierten Kupfern zur deutschen Literatur von Arnim und Brentano bis zu Tieck und Wieland überhäufte, machte daraus ein florierendes Geschäft. Auch ihn träfe wohl Goethes böses Wort über Chodowiecki als "Handwerker, der die elendsten Sudeleien mit seinen Kupfern illuminirt" habe.
Gegen solche Urteile über ein minderwertiges, zur bloßen Unterhaltung betriebenes "Handwerk" zieht Anna Christina Schütz mit ihrer umsichtigen Studie entschieden zu Felde. Mit guten Gründen wirbt sie für eine "Kopräsenz der Kupfer", also die Anerkennung einer eigenständigen Kunst, die Literatur in einem anderen Medium flankiert, ergänzt, oftmals auch ganz neu erhellt. Goethe scheute jedoch das populäre Beiwerk, er fürchtete eine zu starke Lenkung der bildlichen Einbildungskraft, was ihn auch von Illustrationen zum "Faust" abhielt. Schütz' Eröffnung mit dem "Brustbild eines Mädchens, das in ,Werthers Leiden' liest" von Johann Nothnagel ist entsprechend passend. Denn das Kupfer zeigt eine Leserin mit verzückt geschlossenen Augen, den Erfolgsroman mit aufgeschlagenem Titel in der Hand, mit rauchendem, von Amor mit einem Blasebalg angefachten Herzen. Die fatale Wirkung von Werthers suizidaler Liebesleidgeschichte ist bekannt. Als Friedrich Nicolai dem Kult mit einer Parodie Einhalt gebieten wollte, war Goethe empört. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, die ebenfalls von Chodowiecki radierte Titelvignette von der glücklichen Versöhnung Lottes mit dem vernünftig gewordenen Werther auszuschneiden und zu seinen "liebsten Kupfern" zu rechnen.
Schütz konzentriert sich auf die wenigen Illustrationen von Chodowiecki und Daniel Berger zu Goethes "Werther". Die Kupfer, also Porträts der Protagonisten, Szenen am Brunnen, beim Brotschneiden, beim Aufbruch zum Ball, in adliger Gesellschaft, beim Abschied in der Laube, der Ossianlektüre mit Kuss, der Übergabe der Pistolen und im Sterbezimmer sind in den verschiedenen Auflagen von "Goethens Schriften" (1775 bis 1787) verstreut, in der Erstausgabe (1774) also gar nicht zu finden. Diese Illustrationen setzt sie zur Ästhetik von Charakter und Darstellung, von Kontur, Linie, Silhouette oder Schattenriss in Beziehung. Sicher sind diese Kontexte für Chodowieckis graphisches Werk wichtig, etwas knappere Resümees der Forschung zur Ästhetik von Ausdruck und Darstellung, Literatur und Malerei, Körpersprache und Schauspielkunst hätten aber mehr Raum für die Anwendung auf Chodowieckis weiteres OEuvre gegeben.
Auf einer Radierung zu Gellerts Fabel "Der großmüthige Räuber" verweist Chodowiecki auf sein eigenes Tun, wenn er die Signatur "inv. & sc." (invenit et sculpsit) durch eine Handskizze des erfindenden Künstlers am Tisch und dem Drucker an der Presse ergänzt. Solche selbstreflexiven Blätter sind für Goethes Roman sehr erhellend, weil auch Werther mit dem Unsagbarkeitstopos wiederholt sein eigenes Schreiben thematisiert und als bildender Künstler zwar spielende Kinder zeichnen kann, mit einem Porträt Lottes aber scheitert. Solche Wechselwirkungen zwischen Kunst und Poetik aufgedeckt zu haben, gehört zu den nicht geringen Verdiensten dieser Arbeit. Als erste gründliche Monographie zum Literaturillustrator Chodowiecki stellt sie insgesamt einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Buchkunst als eigenständiges Medium dar.
ALEXANDER KOSENINA
Anna Christina Schütz: "Charakterbilder und Projektionsfiguren". Chodowieckis Kupfer, Goethes "Werther".
Wallstein Verlag,
Göttingen 2019, 358 S., geb., Abb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main