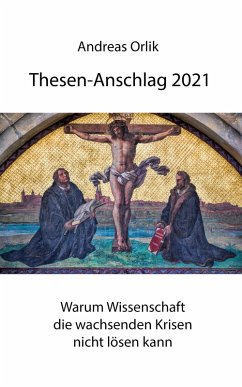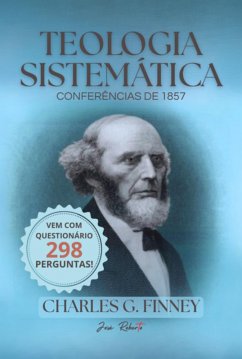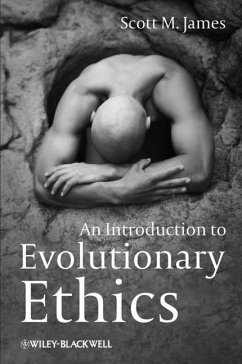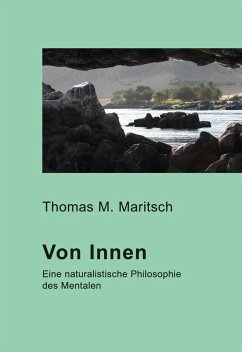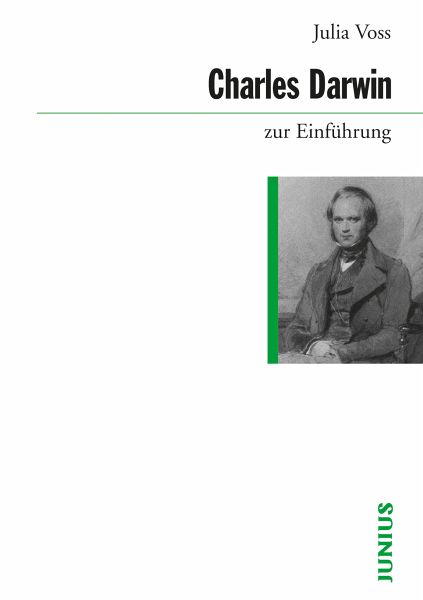
Charles Darwin zur Einführung (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 13,90 €**
11,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Kaum ein Werk hat so weit ausgestrahlt wie das von Charles Darwin (1809-1882): Seine Evolutionstheorie hat Eingang in Philosophie und Geschichtstheorie gefunden, in Soziologie, Kunstgeschichte oder Ethnologie, und steht noch immer im Zentrum der Biologie. Gleichzeitig provoziert kaum eine Theorie so unterschiedliche Reaktionen. Für die einen verkörpert Darwin ein wissenschaftlich aufgeklärtes Weltbild und die Überzeugung, Vorgänge in der Natur mit wissenschaftlichen Methoden erklären zu können - und nicht wie die Kreationisten mit Bibellektüre oder den Eingriffen eines Schöpfergottes....
Kaum ein Werk hat so weit ausgestrahlt wie das von Charles Darwin (1809-1882): Seine Evolutionstheorie hat Eingang in Philosophie und Geschichtstheorie gefunden, in Soziologie, Kunstgeschichte oder Ethnologie, und steht noch immer im Zentrum der Biologie. Gleichzeitig provoziert kaum eine Theorie so unterschiedliche Reaktionen. Für die einen verkörpert Darwin ein wissenschaftlich aufgeklärtes Weltbild und die Überzeugung, Vorgänge in der Natur mit wissenschaftlichen Methoden erklären zu können - und nicht wie die Kreationisten mit Bibellektüre oder den Eingriffen eines Schöpfergottes. Für andere steht Darwin für eine neoliberale Ideologie, die besagt, dass stets der Stärkere siegt. Wie es zu diesen Einschätzungen gekommen ist, legt diese Einführung dar und stellt Darwins Hauptwerke in ihrem Entstehungskontext vor.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.