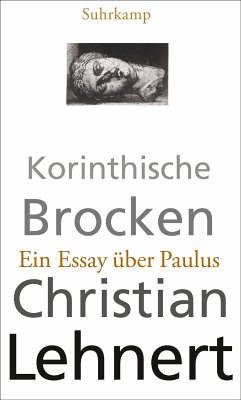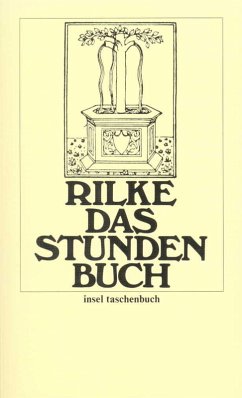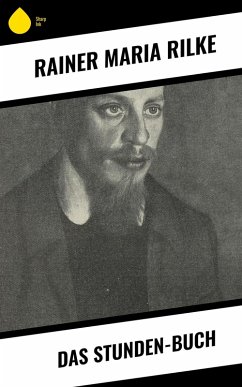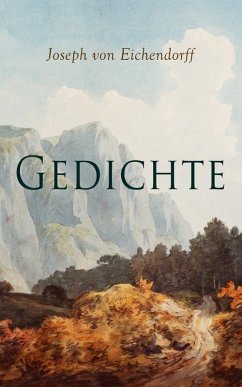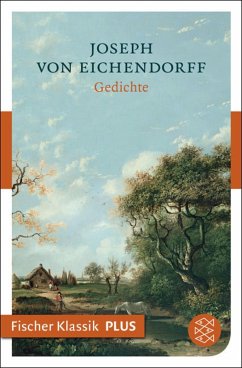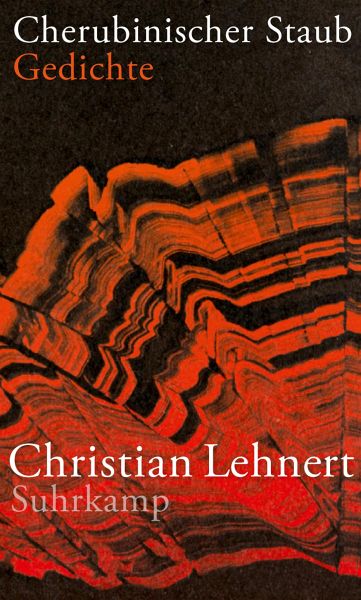
Cherubinischer Staub (eBook, ePUB)
Gedichte
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Christian Lehnerts siebentes Gedichtbuch versucht erneut ein Äußerstes: Ausgehend von zweizeiligen Verknappungen bis an den Rand des Schweigens, über Sonett, Ode und Terzine bis hin zu vielgestaltig ausgreifenden Poemen sendet diese Dichtung experimentelle Sonden ins Unbekannte. Mehrfach begibt sich der Dichter in ein 'Wörterbuch der natürlichen Erscheinungen'. Darin öffnen sich ihm Welt und Signatur von Schnee und Frost, Moos und Laub. Zu Sprache werden ihm Federgeistchen, Feuerkäfer, Fliegen und Falken. Ebenso versteht er sich später auf die Rede der Fichten und Buchen. Schließlich ...
Christian Lehnerts siebentes Gedichtbuch versucht erneut ein Äußerstes: Ausgehend von zweizeiligen Verknappungen bis an den Rand des Schweigens, über Sonett, Ode und Terzine bis hin zu vielgestaltig ausgreifenden Poemen sendet diese Dichtung experimentelle Sonden ins Unbekannte.
Mehrfach begibt sich der Dichter in ein 'Wörterbuch der natürlichen Erscheinungen'. Darin öffnen sich ihm Welt und Signatur von Schnee und Frost, Moos und Laub. Zu Sprache werden ihm Federgeistchen, Feuerkäfer, Fliegen und Falken. Ebenso versteht er sich später auf die Rede der Fichten und Buchen. Schließlich geht es um menschliches Schicksal, um mythische wie historisch-reale Stoffe. Hier verbindet er Polaritäten wie den Baal von Palmyra und die Todeserfahrung des Obersten Lehnert im Zweiten Weltkrieg.
Lehnerts Dichtung speist sich aus der deutschen Mystik. Von Jacob Böhme und Angelus Silesius übernimmt er die doppelbödig-eindringliche, Spiritualität und Physis verbindende Rede. In Lehnerts Gedichten ereignet sich, im vielberufenen Zeitalter des Digitalen, eine Wiederauferstehung analogen Denkens - und hier haben die Gedichte auch ihren widerständigen Ort in der Gegenwart: als Behauptungen von 'Sinn' in den Erscheinungen, als Näherungen an eine letztlich unsagbare Mitte.
Mehrfach begibt sich der Dichter in ein 'Wörterbuch der natürlichen Erscheinungen'. Darin öffnen sich ihm Welt und Signatur von Schnee und Frost, Moos und Laub. Zu Sprache werden ihm Federgeistchen, Feuerkäfer, Fliegen und Falken. Ebenso versteht er sich später auf die Rede der Fichten und Buchen. Schließlich geht es um menschliches Schicksal, um mythische wie historisch-reale Stoffe. Hier verbindet er Polaritäten wie den Baal von Palmyra und die Todeserfahrung des Obersten Lehnert im Zweiten Weltkrieg.
Lehnerts Dichtung speist sich aus der deutschen Mystik. Von Jacob Böhme und Angelus Silesius übernimmt er die doppelbödig-eindringliche, Spiritualität und Physis verbindende Rede. In Lehnerts Gedichten ereignet sich, im vielberufenen Zeitalter des Digitalen, eine Wiederauferstehung analogen Denkens - und hier haben die Gedichte auch ihren widerständigen Ort in der Gegenwart: als Behauptungen von 'Sinn' in den Erscheinungen, als Näherungen an eine letztlich unsagbare Mitte.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.