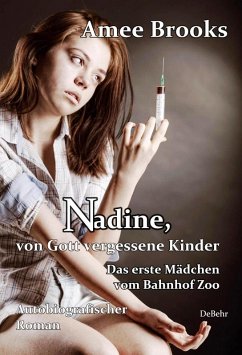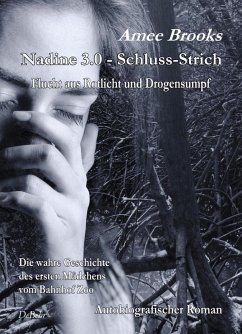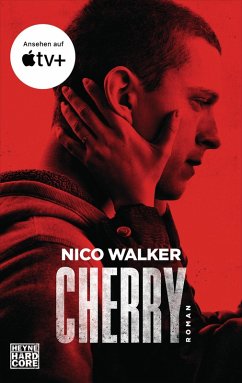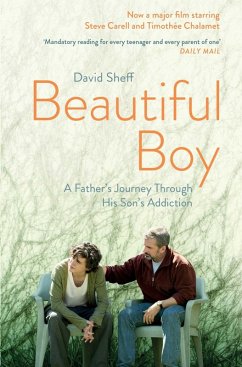Christiane F. - Mein zweites Leben (eBook, ePUB)
Autobiografie
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 17,90 €**
8,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Autobiografie von Christiane Felscherinow 'Mein zweites Leben', ist nicht nur eine Fortsetzung der Geschichte des weltberühmten Mädchens Christiane F. vom Bahnhof Zoo, sondern auch erstmalig das Portrait einer Langzeitabhängigen. Die Co-Autorin Sonja Vukovic begleitete Christiane Felscherinow drei Jahre lang und schaffte es dabei, Wesen und Sprache der Protagonistin authentisch einzufangen. Dazu gehört auch die Sprunghaftigkeit, die sich in den Kapiteln spiegelt. Das Buch 'Mein zweites Leben' bricht bewusst mit dem Titel. Es gibt ein zweites Leben: die einzige Chance, die Christiane Fe...
Die Autobiografie von Christiane Felscherinow 'Mein zweites Leben', ist nicht nur eine Fortsetzung der Geschichte des weltberühmten Mädchens Christiane F. vom Bahnhof Zoo, sondern auch erstmalig das Portrait einer Langzeitabhängigen. Die Co-Autorin Sonja Vukovic begleitete Christiane Felscherinow drei Jahre lang und schaffte es dabei, Wesen und Sprache der Protagonistin authentisch einzufangen. Dazu gehört auch die Sprunghaftigkeit, die sich in den Kapiteln spiegelt. Das Buch 'Mein zweites Leben' bricht bewusst mit dem Titel. Es gibt ein zweites Leben: die einzige Chance, die Christiane Felscherinow jemals genutzt hat. Aber dieses Leben ist nicht ihres, sondern das ihres Sohnes. Die Kapitel, in denen sie ihr Leben erzählt, bilden also keine chronologische Abfolge ihrer Geschichte, sondern handeln von vergebenen Chancen, zurückgewiesener Liebe, Flucht in die Abhängigkeit und neuer Hoffnung. Das zweite Buch räumt mit der Illusion eines Happy Ends und der fast schon romantischen Geschichte des Mädchens auf. Es zeigt nicht zuletzt, dass Abhängigkeiten - in welcher Form auch immer - nicht einfach zu lösen sind. Christiane Vera Felscherinow kam 1962 in Hamburg zur Welt und zog im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie nach West-Berlin. Als Teenager wurde sie heroinabhängig und prostituierte sich auf dem Kinderstrich, um ihre Sucht zu finanzieren. Ende der 1970er Jahre wurden die Journalisten Kai Hermann und Horst Rieck auf sie aufmerksam und verfassten gemeinsam mit ihr eine Serie für die Illustrierte »Stern«, aus der ein autobiografisches Buch entstand. »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« wurde überraschend ein Welterfolg - auch durch den Spielfilm des Produzenten Bernd Eichinger. »Christiane F.« geriet zur Kultfigur und Antiheldin einer ganzen Generation. verbrachte sie zwischen der Hamburger Punk- und Rock'n'Roll-Szene, den griechischen Inseln und dem Berliner Underground sowie in der Obhut einer prominenten Schweizer Verlegerfamilie. Ihre Wege kreuzten Rockstars wie Alexander Hacke (»Einstürzende Neubauten«), David Bowie, Nick Cave, Nina Hagen und Depeche Mode ebenso wie die Literaten Friedrich Dürrenmatt, Patricia Highsmith und Loriot. Bis heute befindet sich Christiane Felscherinow in einem Methadon-Programm für Langzeit- abhängige. 1996 brachte sie einen Sohn zur Welt. Sie lebt heute in der Nähe von Berlin. Sonja Vukovic, geboren 1985 bei Aachen, ist Journalistin und entwickelt crossmediale Konzepte, wofür sie 2010 mit einem Grimme- Online-Award und einem Axel-Springer-Preis ausgezeichnet wurde. Sie schrieb u.a. für die Rheinische Post, Spiegel Online und Die Welt. 2010, im Zuge einer Recherche anlässlich des 30. Jahrestags des internationalen Kinokassenschlagers »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, lernten sich Sonja Vukovic und Christiane Felscherinow kennen - und begannen bald mit der Arbeit an den Memoiren.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.