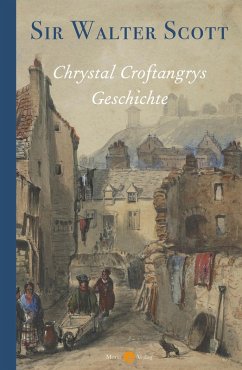Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Walter Scott kommt im Roman "Chrystal Croftangrys Geschichte" zu überraschenden Einsichten
Ein Sechzigjähriger kehrt zum ehemaligen Herrenhaus der Familie zurück, etwas Schlossähnlichem, das inzwischen völlig heruntergekommen ist, modrig riecht und düster anmutet - eine ideale Bühne für einen schottischen Gespensterroman. Walter Scott macht etwas anderes daraus: eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, der eigenen wie der schottischen. Und er tut es im Bewusstsein, dass die Romantiker die Wildnis der nördlichen Inseln bereits ausgewrungen haben. Der wohl meistgelesene Autor Europas im frühen neunzehnten Jahrhundert, den Goethe pries und der Nachahmer in Manzoni, Puschkin oder Hugo fand, der Begründer des historischen Romans also, war um 1825 in eine große Krise geschlittert. Er hatte sich durch massive Kredite für einen Verlag und sein Anwesen Abbotsford hoch verschuldet und musste, ähnlich wie Mark Twain später, wie eine Maschine schreiben, um seine Gläubiger zu befriedigen, was jedoch erst nach seinem Tod gelang.
Lange hatte er anonym seine schottischen Romane über die nähere Vergangenheit geschrieben - er war einfach "der Autor der Waverley-Romane". Doch nun musste er Farbe bekennen. Als Walter Scott schrieb er Auftragsarbeiten wie etwa eine neunbändige Biographie Napoleons. Doch konnte er währenddessen seine romantisch- erzählerische Ader nicht ruhen lassen. Parallel zur Brotarbeit also entstanden weiter Romane und Erzählungen. Das Begleitwerk zu Napoleon wurden die Erzählungen von Chrystal Croftangry, die nun in einer neuen Übersetzung auf Deutsch vorliegen. Chrystal Croftangry - der gälische Name bedeutet "Gut des Königs" - ist jener anfangs erwähnte Sechzigjährige, und er ist zu einem guten Teil auch Scott selbst. Die Romanfigur hat ihr Erbe durch Spielsucht verjubelt, nun will sie sich durch das Schreiben retten.
Zunächst also ein Besuch im Schloss der Ahnen, das ihm nicht mehr gehört, ein Besuch, der ihn desillusioniert. Warum soll er auf dem Lande wohnen? Es ist unbequem dort, zu viel Luftzug, keine Bibliotheken! Jetzt hilft nur noch, sich durch Schreiben die Welt zurückzuerobern, die Vergangenheit, die Welt der Ahnen, zu denen er real keinen Zugang mehr hat. Wie Abbotsford, jenes Schloss im Baronial Style, das Scott nach einem Wort Fontanes "einem halben Hundert Schlagwörter zu Liebe gebaut" hatte, einen architektonischen Versuch darstellt, die Vergangenheit in ein Mausoleum zu bannen, so bemühte sich der Schriftsteller in seinen Romanen, das alte Schottland wieder aufleben zu lassen. Doch nicht ohne Selbstironie. Das ist etwas, was wir mit Scott nicht oft verbinden, doch möglicherweise wird es besonders aktiv, wenn der Autor unter Schreibdruck gerät.
Der orientierungslose Chrystal besucht die alte Hausdienerin, die ihn nicht erkennt und umso bissigere Kommentare über ihn als einstigen Herrensohn auf Lager hat. Das hilft ihm, realistischer zu werden, das Projekt Rückkehr anders als im Wiedererwerb seines eigenen Hauses zu finden. Nein, es soll die Literatur sein, in der er sich Heimat und Vergangenheit von nun an erschafft. Chrystal lässt sich - wie zur selben Zeit auch die Brüder Grimm - von einer alten Dame Geschichten aus dem alten Schottland erzählen und bringt sie zu Papier. Darin geht es um die Wildheit und die Ehre der von den Briten in Culloden geschlagenen Hochländer, also auch um die Beziehungen zwischen Moderne und Archaik, zwischen (englischen) Institutionen und schottischen Clantraditionen, also auch um Kolonialismus, Gewalt, Widerstand, Irrationalität in einer sich wandelnden Gesellschaft.
Die erste Erzählung handelt von der Witwe eines Hochlandräubers, die ihren Sohn gern in den Fußstapfen des Vaters sähe. Aber nein, er schließt sich lieber den britischen Rotröcken an, die in Nordamerika gegen die Unabhängigkeitsbewegung der Amerikaner kämpfen. So weit kommt es jedoch nicht, denn der junge Mann wird mit einem Hexentrank seiner Mutter zu Hause zurückgehalten, sodass ihm nun Strafe fürs Desertieren droht, und die ist entehrend. Als die Strafexpedition ihn abholen will, erschießt er deren Anführer. In einem Gerichtsprozess versucht der Richter Verständnis für die Zwickmühle aufzubringen, in die der Hochländer geraten war: zwischen Mutter und Pflicht. Es hilft nichts, er wird exekutiert.
Ähnlich blutig auch die Geschichte von zwei Viehtreibern, der eine Hochländer, der andere Engländer, die gute Freunde sind. Doch aufgrund eines Missverständnisses werden sie zu giftigen Feinden. Hier zeichnet Scott die intrikaten Linien auf, die zwischen Menschen entstehen können, wenn sie zwischen ihren moralischen Werten und den Clans stehen, denen sie auch zugehören und deren Verhalten in Fleisch und Blut übergegangen ist. Gerade in dieser Geschichte zeigt der Autor Gerechtigkeitssinn und erinnert, in kleinerer Form, an "Hadschi Murat", den großen Roman von Tolstoi, in dem es um ähnliche Konflikte zwischen Nordkaukasiern und Russen geht - und die sind bis heute noch nicht beendet: "Beide haben Anspruch auf unser Mitleid, denn es handelt sich um Männer, die aus Unkenntnis über die Denkweisen im Land des jeweils anderen handelten; sie waren lediglich irregeleitet und nicht vorsätzlich vom Pfad des richtigen Verhaltens geraten." Viele Konflikte laufen auch heute genau an dieser Linie entlang.
Scott beschwört natürlich auch ein altes Schottland mit dessen Aberglauben und Schwüren, mit emotionalen Ausbrüchen und knochenharten Einstellungen. Macbeth ist nicht weit, die Niederlage der Jakobiten - also der Anhänger des Bonnie Prince Charlie, auf dessen Rückkehr sie hofften und für den sie gegen die Engländer kämpften - sitzt wie ein Stachel in den Erzählungen, und auch Stevenson, der andere große schottische Schriftsteller, sollte sich daran weiter reiben. Scott, dessen Bild heute schottische Banknoten ziert, hat auf seine Weise versucht, die Urfeinde und doch oft Verbündeten England und Schottland näherzubringen. Insbesondere als er den ersten Besuch eines englischen Königs seit 170 Jahren in Edinburgh organisierte und dies zu einem großen PR-Ereignis machen konnte, ging es ihm um die Heilung alter Wunden. In seinen Erzählungen bilden die Tartans und Kilts symbolische Abgrenzungen, denn sie waren von den Engländern verboten worden. Als Georg IV. nun nach Edinburgh kam, trumpfte Scott als Regisseur mit Schottenröcken und Dudelsackparaden auf. Das Verbotene erhielt einen öffentlichen Auftritt, der englische König wurde als Hochländer eingekleidet. Die Aufmärsche zu seinen Ehren halfen der Nation, zu einer wenigstens symbolischen Identität zu finden, sodass die Monarchie sich bis heute gern ins schottische Balmoral begibt und Touristen sich mit Kilts und Tartans eindecken.
Der mit Kinderlähmung geschlagene Scott war einer der produktivsten Menschen, die man sich vorstellen kann, sowohl in der realen wie in der imaginären Welt. Seine antiquarische Seite diente ihm ähnlich wie der Nation als Rückzug von den Erfordernissen der Moderne, aber sie gab ihm auch die Kraft, diese weiter voranzubringen. Die Erzählungen, die in der Übersetzung um eine indische Episode gekürzt wurden, werden abgerundet durch die Zweifel, die der Autor im Text an seinen Werken hat. Ein Freund, dem er sie vorlegt, antwortet vorsichtig: Ja, "Die Räuber" von Schiller, die lege man nicht so leicht aus der Hand, aber Chrystals Erzählungen, gibt er zu bedenken, hätten den Vorzug, dass man sie aus der Hand legen könne. Darauf muss sich Chrystal erst mal einen Reim machen. Der Autor Scott aber hatte seinen Spaß daran, und wir haben ihn nun mit ihm. ELMAR SCHENKEL.
Sir Walter Scott: "Chrystal Croftangrys Geschichte".
Hrsg., aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Michael Klein. Morio Verlag, Heidelberg 2021. 318 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main