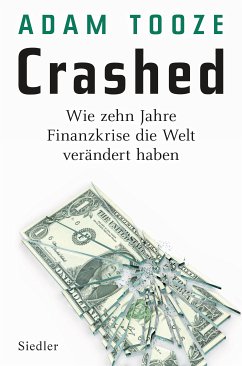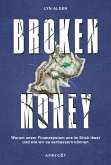Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Die Finanzkrise hat die Macht auf der Welt neu verteilt. Regierungen wurden gestürzt, Donald Trump kam ins Amt. Und die Deutschen spielen bis heute eine unglückliche Rolle, schreibt der Historiker Adam Tooze in seinem neuen Buch. Ralph Bollmann hat es gelesen.
Als der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze vor ein paar Jahren begann, ein Buch über die weltweite Finanzkrise von 2008 zu schreiben, hielt er das Thema für beendet. "Es sollte zum Jahrestag der Rückblick auf eine Krise sein, die zum Abschluss gekommen ist", schreibt er selbst. 2008 hatte das Desaster mit dem Zusammenbruch der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers begonnen, 2012 war es mit der Euro-Rettung von EZB-Präsident Mario Draghi ("Whatever it takes") beendet, so sahen es damals die meisten Beteiligten.
Jetzt ist das Buch im englischen Original erschienen (die deutsche Ausgabe folgt nächsten Monat), und das Jubiläum steht vor der Tür: Am 15. September ist es genau zehn Jahre her, dass die Lehman-Manager Gläubigerschutz beantragten und die Welt ins Chaos stürzten. Aber dass die Geschichte der Finanzkrise schon beendet ist, glaubt Adam Tooze längst nicht mehr. Und das nicht allein wegen der ökonomischen Risiken, die allenthalben noch lauern. Sondern vor allem wegen der politischen Folgeschäden, die inzwischen eingetreten sind.
Denn der Niedergang der liberalen Demokratie, so lautet die zentrale These von Tooze, ist im Wesentlichen eine Spätfolge des Desasters von 2008. Nicht allein die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten, den Brexit oder die politischen Turbulenzen in Südeuropa bezieht er in diese Diagnose ein. Sogar für die autoritäre Wende in Ungarn, Russland oder der Türkei macht er den Bankencrash und seine Folgen (mit-)verantwortlich. Selbst das neue Selbstbewusstsein Chinas fehlt nicht in der Reihe der Nah- und Fernwirkungen. "Crashed", zu Deutsch: abgestürzt, wie der Titel des Buchs lautet, ist nicht allein die Finanzbranche, sondern die gesamte Weltordnung, wie wir sie kannten.
Der britische Historiker, der nach Jahren in Cambridge und Yale heute an der New Yorker Columbia University lehrt, ist mit einem Buch über die nationalsozialistische "Ökonomie der Zerstörung" berühmt geworden und hat zuletzt mit einer Studie über die amerikanische Verantwortung für das weltweite ökonomische und politische Desaster der Zwischenkriegszeit Furore gemacht ("Sintflut"). Was die Größe von Thema und These betrifft, braucht auch seine neue Arbeit keinen Vergleich zu scheuen, und die Parallele zu 1914 zieht er selbst: Mit der Finanzkrise könnte - wie damals mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs - eine Epoche von Maß und Mitte zu Ende gegangen sein.
Überraschend ist die These vor allem für deutsche Leser. Weil Deutschland die Krise vergleichsweise schnell und reibungslos hinter sich ließ, ist hierzulande die Neigung groß, ihre Folgewirkungen zu unterschätzen. Bankencrash, Griechenland-Pleite, Ukraine-Konflikt: Aus der Perspektive der heimischen Öffentlichkeit erscheinen diese Großkrisen der zurückliegenden Jahre als eine zufällige Abfolge schwerwiegender Probleme, bei denen nicht unbedingt ein innererer Zusammenhang ersichtlich ist. Wie lange viele Länder noch an den Folgen der Finanzkrise laborierten und welche persönlichen Dramen sich dabei in anderen Teilen der Welt abspielten, macht sich bis heute in Berlin oder München kaum jemand klar.
Das gilt zunächst einmal für Amerika selbst. Minutiös zeichnet Tooze die Schlachten nach, die das Weiße Haus und der Kongress in den letzten Tagen der Bush-Regierung um das Programm zur Bankenrettung schlugen ("Troubled Asset Relief Program", TARP): Für Tooze sind das die Tage, in denen in der Republikanischen Partei das ohnehin prekäre Bündnis zwischen Eliten und Populisten endgültig zerbrach. Nur mit Hilfe der Demokraten konnten Bush junior und sein Finanzminister Henry Paulson das Gesetz durchs Parlament bringen, die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten ging von der Fahne.
Damit war, glaubt man Tooze, das Fundament für den späteren Aufstieg von Donald Trump schon gelegt. Hinzu kamen die Folgen der Krise gerade für die weiße Arbeiterklasse oder das, was von ihr übrig geblieben war. Mehr als neun Millionen Familien verloren ihre Häuser, weitere Millionen erlebten Jahre der Angst, weil sie Hypotheken zurückzahlen mussten, die weit höher waren als der verbliebene Wert ihrer Immobilie. Das alles bleibt eine traumatische Erfahrung und ein Quell tief sitzender Ängste, auch wenn die amerikanische Wirtschaft wieder brummt und die Statistik praktisch Vollbeschäftigung ausweist.
Letzteres ist laut Adam Tooze das Verdienst des amerikanischen Krisenmanagements, das bei ihm gut wegkommt - anders als die Politik der Vorkrisenzeit (und der Entschluss, Lehman fallenzulassen). Das positive Urteil gilt nicht nur für das erwähnte Gesetz zur Bankenrettung. Es gilt auch für die Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank, die unter ihrem damaligen Chef Ben Bernanke die Märkte mit Geld flutete, und es gilt für die vergleichsweise strikte Bankenregulierung, die mit dem Dodd-Frank-Act unter dem neuen Präsidenten Barack Obama folgte. Das Gesetz führte zwar nicht zu einer fairen Verteilung der Krisenlasten, aber zu einer raschen Konsolidierung der Finanzbranche, die in Europa vorerst ausblieb.
Im Kontrast dazu fällt Tooze ein vernichtendes Urteil über das europäische Krisenmanagement, und das heißt vor allem: über das Verhalten der Deutschen und ihrer Bundeskanzlerin, die damals schon Angela Merkel hieß. Bekanntlich stemmte sich die Regierungschefin gegen eine gemeinsame europäische Bankenrettung; was es gab, war lediglich eine lockere Koordinierung der jeweiligen nationalen Hilfsprogramme. Mehr noch: Bereits im Frühjahr 2009 warnte Merkel bei jeder Gelegenheit vor den Risiken, welche die Konjunkturprogramme und die damit verbundene Neuverschuldung bargen, und verlangte eine "Exit-Strategie". Was aus Sicht der Kanzlerin im Licht der folgenden Staatsschuldenkrise geradezu als prophetische Warnung gelten mochte, erscheint aus der Perspektive des angelsächsischen Wirtschaftshistorikers als gefährliche Marotte der Pastorentochter, die in jenen Monaten gern mit einem Aufsatz des Soziologen Ralf Dahrendorf über protestantische Wirtschaftsethik und die Gefahren der Schuldenmacherei herumwedelte.
Dass sich im folgenden Winter die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands abzuzeichnen begann, ist für Tooze im Rückblick keineswegs der Beginn einer neuen Krise, sondern die Fortsetzung der Finanzkrise auf einem anderen Schauplatz. Den Begriff der "Staatsschuldenkrise" lehnt er ab, weil er keineswegs eine exzessive Kreditaufnahme der Regierungen als Wurzel des Übels sieht, sondern ganz im Gegenteil deren Zögerlichkeit in der ersten Phase der Krise. Über das Urteil zum Krisenmanagement mag man streiten. Der Nexus zwischen Finanz- und Schuldenkrise lässt sich kaum leugnen
Neben Staaten wie Griechenland oder Italien, die tatsächlich schon mit einer hohen Schuldenlast in die Krise hineingingen, standen Länder wie Irland, dessen Staatsfinanzen unter der Rettung des überdimensionierten Finanzsektors zusammenbrachen, oder wie Spanien, das damals einen äußerst niedrigen Schuldenstand verzeichnete und wie Amerika das Platzen einer Immobilienblase erlebte. Selbst in Italien war weniger die absolute Höhe der Verbindlichkeiten das Problem, die das Land schon seit einem Vierteljahrhundert mit sich herumschleppte, als das ausgebliebene Wirtschaftswachstum der bleiernen Berlusconi-Jahre.
Das Desaster an den Finanzmärkten traf die Krisenländer gleich mehrfach. Selbst wenn die Regierungen keinen Cent für Bankenrettung oder Konjunkturprogramme ausgegeben hätten, litten sie unter den Folgen, die der Bankencrash von 2008 auf die Realwirtschaft hatte: Steuereinnahmen brachen ein, Sozialausgaben stiegen drastisch an. Hinzu kam die gewachsene Nervosität der Investoren, die nun nicht mehr jedes Staatspapier unbesehen kauften - und die, wie Tooze findet, durch die deutsche Zögerlichkeit bei der Krisenbekämpfung weiter verunsichert wurden.
Zwei Jahre dauerte die Phase der Ungewissheit, vom ersten Hilfspaket für Griechenland 2010 bis zur vorläufigen Beruhigung der Krise 2012, als der neue EZB-Präsident Draghi seine Garantie für die Verteidigung der Gemeinschaftswährung ausgab, das deutsche Verfassungsgericht die Hilfspakete billigte und sich Merkel ein weiteres Mal zur Unterstützung Griechenlands entschloss. Auch für diese Hinhaltetaktik tadelt Tooze die Kanzlerin. Zweimal, in Cannes 2011 und in Los Cabos 2012, widersetzte sie sich dem Drängen des amerikanischen Präsidenten Barack Obama, einmal sogar unter Tränen. Für diese Phase billigt er ihr aber mildernde Umstände zu: Anders als zuvor in der großen Koalition war ihr Spielraum angesichts der knapperen Mehrheit eingeschränkt, zumal im Bündnis mit einer euroskeptischen FDP.
Zu den Folgen der Finanzkrise gehört in dieser Perspektive auch die Gründung der AfD, die sich in der Anfangsphase gegen die Europolitik richtete und erst später auf das Flüchtlingsthema umschwenkte. Auch in Italien lässt sich der politische Aufstieg der Lega und mehr noch der Protestpartei Cinque Stelle ohne das wirtschaftliche Siechtum kaum erklären. In Griechenland, Spanien und Portugal wechselten die Regierungen ebenfalls. Allerdings schienen diese drei Länder, die erst ein den siebziger Jahren ihre konservativen Diktaturen abschüttelten, gegen Rechtspopulismus zu dieser Zeit noch weitgehend immun zu sein.
Das ist nur der allgemein bekannte Teil der Geschichte. So sehr waren Deutsche und Kontinentaleuropäer mit den Problemen in der Eurozone beschäftigt, dass sie kaum wahrnahmen, welche Verwerfungen die Finanzkrise andernorts auslöste.
Das gilt zunächst für das Vereinigte Königreich, das als zweites Finanzzentrum der Welt von der Krise so unmittelbar betroffen war wie sonst nur die Vereinigten Staaten. Auf zehn Prozent des Sozialprodukts schnellte die Neuverschuldung 2009 empor. Das kam den griechischen Verhältnissen sehr nahe. Der 2010 gewählte konservative Premier David Cameron reagierte mit einer scharfen Sparpolitik, die den Gegensatz zwischen der wohlhabend-weltoffenen Hauptstadt und den Verliererregionen noch verschärfte. Kurzum: Auch zum Brexit führt, folgt man Tooze, von der Finanzkrise eine ziemlich kurze Linie.
Erstaunlicher mag der Weg erscheinen, der nach seiner Lesart von der Lehman-Insolvenz nach Ungarn oder Russland, in die Türkei oder nach China führt. Die osteuropäischen EU-Mitgliedsländer wurden, so Tooze, mit den Auswirkungen der Finanzkrise weithin alleingelassen. Die EZB fühlte sich nicht zuständig, weil die Länder den Euro (noch) nicht eingeführt hatten. Am schlimmsten traf es das Baltikum: In Lettland fielen die Immobilienpreise um 50 Prozent, die Gehälter im öffentlichen Dienst wurden um 35 Prozent gekürzt, die Arbeitslosenquote stieg auf 20 Prozent, ein Zehntel der Bevölkerung wanderte aus.
Eine weitere Schwierigkeit kam hinzu: Die meisten Schulden in diesen Ländern lauteten auf ausländische Währungen. In Ungarn beispielsweise liefen viele Immobilien- oder Autokredite in Schweizer Franken oder japanischen Yen, die monatlichen Raten in Forint stiegen auf einen Schlag um bis zu 40 Prozent. Der Einsatz für die Schuldner und der Kampf gegen die Banken war eines der Themen, auf die Viktor Orbán seine politische Karriere baute. Das Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF), das in Westeuropa kaum jemand zur Kenntnis nahm, beendete er im Jahr 2013.
Besonders hart traf es die Ukraine, deren bescheidene wirtschaftliche Stabilisierung seit der "Orangenen Revolution" von 2004 vor allem auf ausländischen Krediten beruhte. Auch die Regierung in Kiew musste den IWF um Hilfe bitten, Steuern erhöhen und Ausgaben kürzen. Das brachte die prowestlichen Politiker um jeden politischen Kredit und den russlandfreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch ins Amt. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Umgekehrt erklärt Tooze auch für Russland selbst die zunehmend autoritäre Politik Putins und seines damaligen Staatspräsidenten Medwedew mit den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das von Rohstoffexporten abhängige Land litt vor allem unter dem drastischen Rückgang des Ölpreises, der innerhalb weniger Monate von 145 auf 34 Dollar je Barrel fiel. Die Moskauer Börsenkurse sanken im selben Tempo, die Banken gerieten in Not. Putin suchte nicht nur mit einer aggressiven Außenpolitik von den Krisenfolgen abzulenken. Er nutzte die Rettungsaktionen auch, um die russische Wirtschaft endgültig unter Kontrolle zu bringen. Gemessen an der bescheidenen Wirtschaftskraft des Landes, waren die russischen Hilfsprogramme die größten auf der Welt.
Unter den großen Schwellenländern war neben Russland die Türkei am stärksten von den Folgen der Finanzkrise betroffen. Im Jahresvergleich sank das Sozialprodukt um knapp 15 Prozent, die Arbeitslosenquote erreichte ebenfalls fast 15 Prozent, die Aktienkurse fielen um 54 Prozent. Zwar erholte sich das Land, aber ähnlich wie Putin nutzte auch Recep Tayyip Erdogan dieses türkische "Wirtschaftswunder" geschickt zur Konsolidierung seiner Macht.
Am anderen Ende des Spektrums gelang es China nicht nur, sich von den Folgen der Finanzkrise weitgehend abzuschirmen. Die konstruktive Rolle, die das Land bei der weltweiten Krisenbewältigung spielte, machte die Wirtschaftsmacht mit einen Schlag auch zu einem gewichtigen politischen Faktor. Immer wieder setzte die Regierung in Peking die Amerikaner und Europäer unter Druck, bei der Krisenbewältigung entschiedener vorzugehen. Dass sich die deutsche Kanzlerin unmittelbar nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen vom August 2012 für den Verbleib Griechenlands in der Eurozone entschied, war wohl alles andere als ein Zufall: Die Gesprächspartner dürften ihr klargemacht haben, dass sie sonst keine Staatsanleihen aus dem Euroraum mehr kaufen würden.
Sind also alle Konflikte und Machtverschiebungen der zurückliegenden zehn Jahre eine Folge der Finanzkrise? Das wäre übertrieben, und ganz so apodiktisch sagt es auch Adam Tooze nicht. Andere Faktoren kommen hinzu, von der Geopolitik bis zu kulturellen Konfliktlinien. Der Streit zwischen Russland und dem Westen eskalierte schon im Sommer 2008 im Kaukasus, wenige Wochen, bevor die akute Phase der Bankenkrise begann. Und die Flüchtlingspolitik bleibt ein eigenständiger Faktor. Nicht alles lässt sich mit dem Bankencrash erklären. Aber doch sehr viel mehr, als den Deutschen zuletzt bewusst war.
Adam Tooze: Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World. Allen Lane, London 2018, 706 Seiten.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main