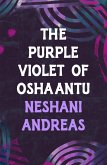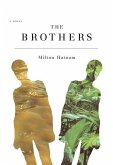Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Robert Seethaler schaut in seinen Romanen
wie durch ein Mikroskop auf Milieus. "Das Café ohne Namen" porträtiert die Wiener Leopoldstadt der Sechzigerjahre.
Geht das auf?
Von Sandra Kegel
Wenn auf dem Friedhof die Toten miteinander sprächen, was wäre ihr Thema? Natürlich das Leben. Robert Seethaler schnitzte aus dieser Konstellation 2018 seinen Roman "Das Feld", der aus neunundzwanzig Perspektiven von den Schicksalen einer fiktiven Kleinstadt erzählt: "Als Lebender über den Tod nachdenken. Als Toter vom Leben reden. Was soll das? Die einen verstehen vom anderen nichts", heißt es da über eine Welt, in der es keine Transzendenz und keinen Glauben an ein Jenseits mehr zu geben scheint.
Seethaler hat das Talent, Charaktere und Landschaften ganz ohne Geschwätz oder Schwerfälligkeit zu erzeugen in der für ihn so typisch entschlackten und schnörkellosen Sprache. Wie schon in seinem Bestseller "Ein ganzes Leben", der 2014 auf der Shortlist des Internationalen Booker Prize stand, verbindet er realitätsgesättigte Präzision gern mit stilistischer Enthaltsamkeit. Auf nur 150 Seiten porträtiert er da tatsächlich das ganze Leben eines hinkenden Tagelöhners, der kaum je sein Tal verlassen hat. Wie durch ein Vergrößerungsglas schaut der 1966 in Wien geborene und seit vielen Jahren in Berlin lebende Schriftsteller auf die Mikrokosmen solch vermeintlich kleiner Welten.
Nach seinem jüngsten literarischen Ausflug mit Gustav Mahler auf einem Ozeandampfer nach New York ("Der letzte Satz", 2020) kehrt Seethaler in seinem neuen Roman räumlich und stofflich zu seinen Anfängen zurück. Die Zeit ist zwar eine andere als in seinem frühen Überraschungserfolg "Der Trafikant" von 2012 über die fiktive Begegnung eines Landburschen aus dem Salzburgischen mit Siegmund Freud im Wien der Wendejahre 1937/38. "Das Café ohne Namen" spielt in der Wiener Nachkriegszeit, doch der literarische Kniff ist ähnlich. Denn so, wie "Der Trafikant" nicht zuletzt daraus Effekte erzielt, dass er auf das historische Bewusstsein des Lesers spekulierend gar nicht erst groß auf den Horror zu sprechen kommt, auf den Wien, Europa und ja die ganze Welt zusteuert, hält sich auch der allwissende Erzähler im "Café ohne Namen" mit Anspielungen auf diese hier noch so beißend nahe Vergangenheit zurück.
Mit dem Wiener Kaffeehaus freilich hat das titelgebende Café nichts gemein. Es ist ein schlichtes, in die Jahre gekommenes Gasthaus, das neben Kaffee, Tee und Himbeersoda vor allem Alkohol und Schmalzbrote kredenzt. Und auch die Kundschaft ist so weit entfernt vom bürgerlichen Wiener Kaffeehausbesucher, der als Romanschreiber oder Ministerialrat über die Welt philosophiert, wie jedenfalls damals noch der erste vom zweiten Wiener Gemeindebezirk, wo der Roman angesiedelt ist.
Seethalers Charaktere sind seit je wortkarg, die sich oftmals keinen Reim auf sich und die Geschicke ihres Lebens machen können. Dabei steht ihnen hier aufs Neue auf die Stirn geschrieben, wie sehr sie noch immer unter dem traumatischen Eindruck stehen von dem, was gerade einmal zwanzig Jahre zurückliegt. Dreh- und Angelpunkt des "Trafikanten" war die von einem Kriegsinvaliden (des Ersten Weltkriegs) geführte Tabaktrafik. Hier ist das Café zentraler Schauplatz und Kreuzungspunkt bisweilen irrlichternder Figuren. Eröffnet hat es der Gelegenheitsarbeiter Robert Simon 1966 am Karmelitermarkt, damals eine der ärmsten und schmutzigsten Gegenden Wiens, in der die Schutthalden des Kriegs noch immer nicht abgetragen und Vierteltelefonanschlüsse eine Seltenheit sind. Der einunddreißigjährige Simon, Untermieter einer Kriegerwitwe, spürt "das Pochen in seinem Herzen", als er den staubigen Gastraum mit den welken Tapeten zum ersten Mal betritt. Doch ist er keiner, der den Ehrgeiz hätte, am wirtschaftlichen Aufschwung jener Jahre zu partizipieren, der sich in den Baustellen und Neubauten manifestiert, die an jeder Ecke in die Höhe schießen. Auch, dass die Zeitungen prophezeiten, "aus dem Sumpf der Vergangenheit" werde sich nunmehr eine "strahlende Zukunft erheben", geht an Simon wie spurlos vorbei. Er steht vielmehr Tag und Nacht hinterm Tresen, wischt seine Gläser und kümmert sich um geplatzte Bierschläuche oder Lieferantenrechnungen.
Seethaler porträtiert hier ein bestimmtes Wiener Milieu in jener diffusen Zwischenzeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs und vor dem Fall der Mauer, ehe diese viel zu große Stadt für ein klein gewordenes Land aus dem Schatten des Eisernen Vorhangs wieder hervortrat. Für die Leute hier wird indes der Einsturz der Reichsbrücke 1976 zum Symbol für die Zeitenwende. Als ein Mann, gefragt, warum er weine, antwortet, weil es nun mit dem alten Österreich für immer vorbei sei, glaubt er zwar, dass nun bessere Zeiten anbrächen, aber eben auch andere, und daran müsse man sich erst gewöhnen. In den Roman verpackt hat der Autor eine staubige Liebeserklärung an den zweiten Bezirk. Die sogenannte Leopoldstadt zwischen Augarten und Lusthaus, die sich inzwischen so tiefgreifend verwandelt hat, dass sie vom vornehmen ersten Bezirk gegenüber dem Donaukanal kaum mehr zu unterscheiden ist, war damals ein Armeleuteviertel. Rund um den Wurstelprater mit seinem ikonischen Riesenrad und den niedrigen Mieten siedelten Arbeiter, Bettler, Kriminelle und Künstler.
Um sie, die vermeintlich einfachen Leute, die es in Simons Café zieht, ist es Seethaler zu tun. Der Wirt, der als Kriegswaise in einem Heim aufwuchs und "zu verwirrt, um richtig traurig zu sein", noch als Erwachsener von grundlegender Verunsicherung gezeichnet ist: "Ich meine, wer bin ich denn schon?" Mit fast schon argloser Menschenliebe empfängt er Schichtarbeiter, Markthändler und Fabrikmädchen, deren innere Monologe sich in Einschüben immer wieder unter die Erzählung mischen: Der Fleischermeister, der nicht mehr weiß, wie er die Familie unterhalten soll, oder René Wurm, der Ringer vom Heumarkt, der es mit Gegnern wie dem "georgischen Bären" zu tun hat, wenn er sich nicht gerade als Kartenverkäufer im Prater verdingt, der Fischhändler Wessely oder Blaha, dem ein Granatsplitter ehedem das Auge ausgeschlagen hat, der aus Russland stammende Künstler Mischa Troganjew oder die arbeitslose Mila, Simons rechte Hand, sie alle finden sich wieder unter diesem Café-Mikroskop.
Die Seethaler'sche Minimalisierung aber stößt irgendwann an ihre Grenzen. Denn so beschädigt das Personal durch die Kriegserfahrung auch ist und so umstürzend die Ära der Sechziger- und Siebzigerjahre, kommt das in diesem Roman kaum je vor, allenfalls als stichwortartiges Hintergrundrauschen, wenn das Bauvorhaben der UNO-City Erwähnung findet oder einmal der Name Bruno Kreisky fällt, der immerhin für eine ganze Generation in Österreich zum Inbegriff wurde für Modernisierung und Weltoffenheit. Urbane Mobilität wird mit der neuen U-Bahn angerissen, soziale Mobilität mit geäußerter Angst vor "Chinesen im Anmarsch". Doch kommen diese Partikel vor allem als Zeitkolorit daher, wie man das aus Fernsehfilmen kennt, wenn mit einem einzelnen Requisit oder einer Dialogzeile der Anschluss an die große Historie gelingen soll. Das geht meist schief.
Nun kann man dem Autor zugutehalten, dass er ja gerade das zeigen will. Dass Zeitgeschichte für seine Protagonisten tatsächlich keine Rolle spielt, allenfalls als Stammtischgeraune. Dann aber stellt sich die Frage umso drängender, was eigentlich "Das Café ohne Namen" erzählen will, das weder wie "Ein ganzes Leben" sich bis in die kleinsten Verästelungen eines Bewusstseins vertieft noch eine polyphone Erzählung ist wie "Das Feld". Die Mittellage birgt das Problem, dass den Figuren zu häufig nicht der Sprung aus der Schublade gelingt. Zu häufig stemmen hier Frauen ihre Arme resolut in die Seite oder muss der Gastwirt mit "Schürze und Bleistift hinterm Ohr" insgeheim "lächeln", wenn er an "die verlorenen Seelen dachte, die sich jeden Tag in seinem Café zusammenfanden". Der Ringer René muss gar Sätze sagen wie: "Ich bin nicht der Schlauste und hab kaum mehr als zwei Paar Schuhe im Schrank. Aber ich hab Muskeln und kann was wegstecken, außerdem bin ich ein guter Kerl, oder?"
Seethalers Fähigkeit, ins Innere von Menschen zu schauen und so etwas wie das Innere einer Zeit zu destillieren, ist einer hölzernen Zeichnung gewichen, die allzu oft im Gemeinplatz hängen bleibt. Sicher, es gibt Sätze, die in ihrer vermeintlichen Harmlosigkeit verräterisch sind, so etwa, wenn ein Cafébesucher vor sich hin säuselt, noch einmal jung sein zu wollen, denn da habe "ein Kuss unter der Laterne noch genügt für ein ganzes Glück. Im Rückblick sieht alles besser aus." Da taucht einer, dem der Kriegsschlager "Lili Marleen" noch im Kopf hängen geblieben ist, seine Jugend in ein goldenes Licht, deren Gegenwart tatsächlich das millionenfache Töten war. Geschichtsblindheit wird mit Sprüchen wie dem eines Vaters illustriert, der seinem Sohn sagt: Bloß nicht zurückschauen, das Leben liege doch vor ihm. "Aber was soll ich ständig noch vorn schauen", wendet der Sohn ein, "wenn da nichts mehr ist?"
Mit solch aufschließenden Momenten geizt der Roman. Einmal erfahren wir von einem, dass er "Nazi" war, einmal marschieren schwarze Stiefel, aber dann ist es nur ein Traum während eines Feuers, und die Stiefelträger sind Feuerwehrleute. Vielleicht würde es den Roman überfrachten, Österreichs Verstrickung in den NS-Terror zu thematisieren, die zu dieser Zeit an die Oberfläche drängte, während man zugleich am Mythos vom überfallenen Land festhielt. Dass aber der Roman der Leopoldstadt und ihren Bewohnern gewidmet ist und außen vor lässt, wie sehr der Holocaust gerade hier, im ehemals größten Judenviertel der Stadt, gewütet hat - von den 60.000 Juden dort haben die wenigsten überlebt -, bleibt unerklärlich.
"Am besten man sucht sich ein schattiges Platzerl im Leben und hält still", sagt einer im Roman und soll wohl für diese Haltung stehen: Die Nazis, das sind immer die anderen. Auch wenn es im "Feld" hieß, als Lebende über den Tod nachzudenken sei sinnlos, hängt er den Menschen ja doch im Genick. Georg Kreislers bitteres Wiener Lied "Tauben vergiften" führt vor, wie das geht: die Feigheit der Leute, die auch rückwirkend gilt, in verstörende Bilder zu packen. Auch bei Seethaler kommen Tauben vor, aber hier werden sie vergiftet von den Wirtsleuten.
Robert Seethaler: "Das Café ohne Namen". Roman.
Claassen Verlag, Berlin 2023. 288 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main