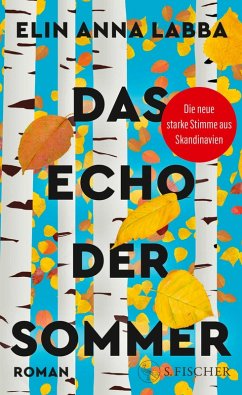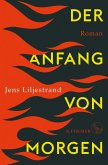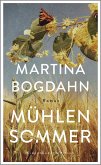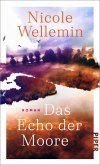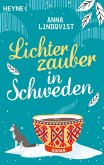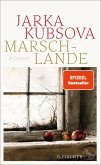Drei Frauen, ihre sämische Gemeinschaft und ein Aufbegehren, gegen die Macht der Anderen
Es sind die 1940er-Jahre, die dreizehnjährige Ingá, ihre Mutter Rávdná und deren Schwester Ánne sind auf dem Weg von ihrem Winterquartier zum 'Sommerland'. Als sie dort ankommen, hat die staatlich angeordnete
Überflutung bereits begonnen und sie können nur noch das allernötigste von ihrem Hab und Gut…mehrDrei Frauen, ihre sämische Gemeinschaft und ein Aufbegehren, gegen die Macht der Anderen
Es sind die 1940er-Jahre, die dreizehnjährige Ingá, ihre Mutter Rávdná und deren Schwester Ánne sind auf dem Weg von ihrem Winterquartier zum 'Sommerland'. Als sie dort ankommen, hat die staatlich angeordnete Überflutung bereits begonnen und sie können nur noch das allernötigste von ihrem Hab und Gut retten. Es wird nicht das letzte Mal sein, das der schwedische Staat eine solche Entscheidung trifft, um die Energieressourcen für ihre eigene Bevölkerung weiter auszubauen. Die Zerstörung des Lebensraums der indigenen sämischen Gemeinschaft, deren Bedürfnisse, vielleicht ja auch Rechte, die Verzweiflung, mit der sie zurückgelassen werden, sie werden nicht hinterfragt. Sollen sie doch, ihrem traditionellen Leben mit der Natur entrissen, in die Städte ziehen und sich angleichen. Und vor allem Aufbegehren, das ist nicht vorgesehen. Doch vor allem Rávdná tut genau das, sich mit ihren bescheidenen Mitteln dagegen wehren. Doch letztendlich beschreitet jeder der drei einen anderen Weg, in ihrem Handeln nach außen und in ihrer Haltung in sich selbst. Und so erleben wir das Leben dieser drei Frauen stellvertretend für das Dasein der Samen in einem Land, das einst auch das ihre war. Dreißig Jahre später dann hat sich viel verändert, Ingá ist erwachsen geworden, ihre Tante ist gestorben und ihre Mutter, sie macht weiter auf die Art, die für sie die einzige ist, um nicht zu verlöschen.
Diese Geschichte, sie ist real und von der sämisch-stämmigen Autorin aufgeschrieben, um existent zu sein, das Schicksal ihrer Gemeinschaft aufzuzeigen, bei den Menschen außerhalb des kleinen Kosmos, der schweigt. Sie tritt an uns Leser heran, öffnet uns ihr Leben, erzählt von der Natur, beschreibt die besondere ergreifende Beziehung der Samen dazu, ihr Einvernehmen, im friedlichen gegenseitigen Einklang mit ihr zu leben und macht so auch das bewusst, was tatsächlich heute passiert, das rücksichtslose Eindringen in das Gleichgewicht bis hin zur Zerstörung. Und der Preis, er wird nicht gesehen, aber er ist verdammt hoch und irgendwann nicht mehr umkehrbar. Für die Samen ist das schon jetzt der Fall und das macht traurig.
Dies ist ein intensives absolut authentisches Buch, berührend und nachhallend und leider mit wenig Happy-End, weil diese Realität nun mal so ist.