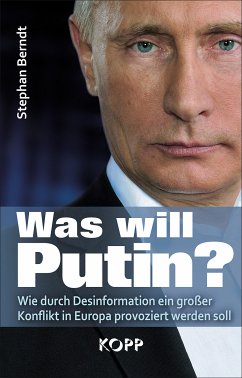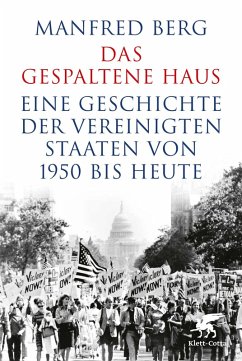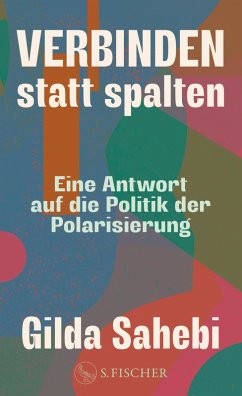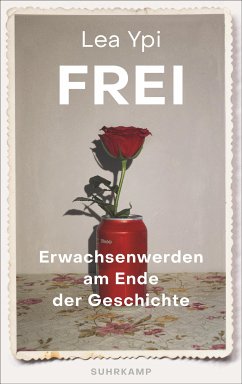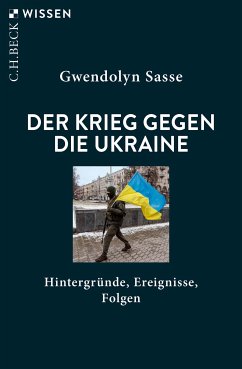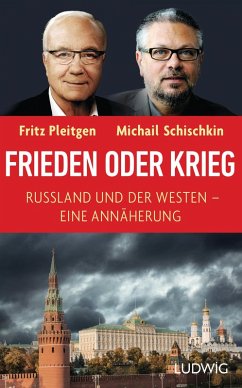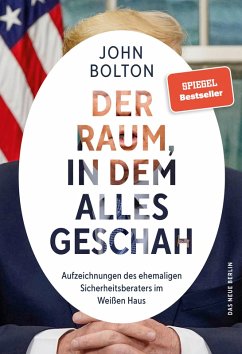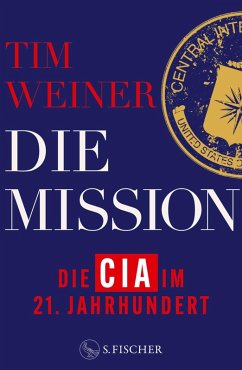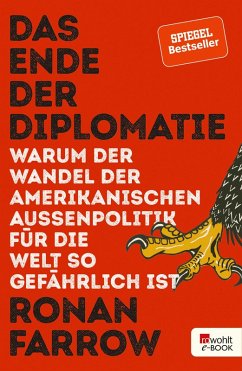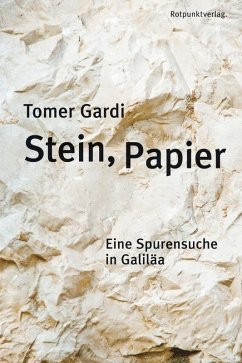Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts (eBook, ePUB)
Richard Holbrookes Mission
Übersetzer: Hens, Gregor
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 34,00 €**
24,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der amerikanische Journalist George Packer beschreibt, wie die USA sich in den vergangenen Jahrzehnten aus der Diplomatie zurückgezogen haben, und dokumentiert den Rückgang des amerikanischen Einflusses in der Welt. Als Leitfigur dient ihm der 2010 verstorbene Spitzendiplomat Richard Holbrooke, in dessen Haltung und Persönlichkeit sein Land zum Vorschein kam: laut, tollpatschig, aber auch optimistisch, idealistisch und pragmatisch. Holbrooke wird bei Packer zu einer übergroßen, tragisch-komischen Figur, mit der das amerikanische Jahrhundert aufblüht und schließlich zu Ende geht: Holbroo...
Der amerikanische Journalist George Packer beschreibt, wie die USA sich in den vergangenen Jahrzehnten aus der Diplomatie zurückgezogen haben, und dokumentiert den Rückgang des amerikanischen Einflusses in der Welt. Als Leitfigur dient ihm der 2010 verstorbene Spitzendiplomat Richard Holbrooke, in dessen Haltung und Persönlichkeit sein Land zum Vorschein kam: laut, tollpatschig, aber auch optimistisch, idealistisch und pragmatisch. Holbrooke wird bei Packer zu einer übergroßen, tragisch-komischen Figur, mit der das amerikanische Jahrhundert aufblüht und schließlich zu Ende geht: Holbrooke stirbt plötzlich im Büro von Außenministerin Hillary Clinton, deren Job er fanatisch gern übernommen hätte. George Packer, Autor der «Abwicklung» und von «Die letzte beste Hoffnung», liefert eine romanhafte Doppelbiografie und spiegelt in Holbrookes Leben die Größe, aber auch das Scheitern des amerikanischen Jahrhunderts.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.