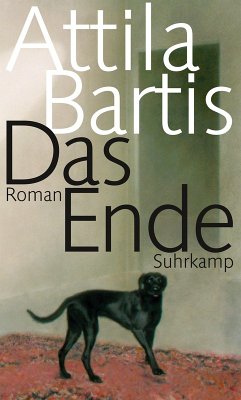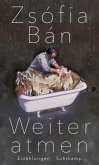Als er Jahrzehnte später vom Unfalltod Évas erfährt, einer nach Amerika emigrierten Pianistin, mit der ihn eine Amour fou verband, beginnt er sein Leben niederzuschreiben - kurze Episoden, gestochen scharfe Dialoge, wie in einem Kammerspiel. Eine unheimliche Kälte und Einsamkeit durchweht diesen Künstlerroman, der um die Frage kreist, woher die Gewalt und die Verletzlichkeit kommen, die András in sich spürt.
»Schöner hat lange niemand mehr von der Düsternis erzählt«, schrieb die FR über Attila Bartis und seinen Roman Die Ruhe. »Unerklärlich die atemberaubende Stilsicherheit« (ZEIT) des jungen Autors, seine »Leichtigkeit im Umgang mit der Last der Geschichte« (NZZ). Fünfzehn Jahre hat Attila Bartis an seinem nächsten Roman gearbeitet: Das Ende ist sein opus magnum: ein Werk, das mit unerbittlicher Genauigkeit von erotischer Abhängigkeit, Lüge und Erpressung erzählt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Größere Phantasten als die Schriftsteller sind die Literaturwissenschaftler. Sebastian Lehmanns Roman "Parallel leben" macht darauf die Probe.
Von Jan Wiele
Ganz ohne parodistischen Reflex scheint es noch immer nicht möglich zu sein, über akademisches Leben in Deutschland einen Roman zu schreiben. Natürlich muss ein alter Germanistikprofessor Zigarillos rauchen, jede Tasse Kaffee mit Rum verlängern und ob seiner ungesunden Lebensweise kurz vor dem Herzinfarkt stehen. Und dann auch noch Sätze raushauen wie "Jedes Seminar, das ich nicht gebe, ist ein gutes Seminar".
Aber auch wenn die Ausgangssituation von Sebastian Lehmanns Debütroman gleichermaßen überzeichnet wirkt - der Doktorand des besagten Professors, Protagonist des Buches, sitzt an einer niemals fertigwerdenden Dissertation über "Konzeptionen der Liebe in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur" -, schafft der Autor es doch, einen schnell für seine Geschichte einzunehmen, weil er trotz mancher Zuspitzung das Lebensgefühl des akademischen Prekariats vermittelt. Und das ist eines, das ziemlich viele Menschen in Deutschland teilen.
Dieser nicht mehr ganz junge Paul also, der einen von Gnaden des Doktorvaters immer wieder verlängerten Dozentenvertrag an der Freien Universität Berlin hat, interessiert sich im Grunde kaum noch für sein Fach, verachtet oder bemitleidet seine Studenten, hat sich aber trotz allem mit seinem Dasein bestens arrangiert: "Die Universität bedeutete für mich einen Ruheraum, ich fühlte mich wohl hier - in den muffigen Gängen, in der Bibliothek, in meinem winzigen Büro, das ich mir mit einem anderen Doktoranden teilte, der höchstens einmal im Monat vorbeischaute, um seine Post abzuholen." Nach fast fünfzehn Jahren Mensa hat Paul zwar noch nicht herausgefunden, "warum alle Gerichte einen penetranten süßen Honiggeschmack aufwiesen", aber nichtsdestotrotz geht er weiter jeden Mittag dort essen, denn was hilft es? "Ich war hier zu Hause."
Im Gegensatz zu seiner Freundin Johanna hat er es da sogar noch gut, denn die gehört zur Generation Praktikum und hat sich jahrelang mit befristeten Stellen ohne eigenen Arbeitsplatz durchgeschlagen. Nun betreut sie Produktionen in einem sehr kleinen Hörbuchverlag. "Diese Artikel über die mobile und flexible Arbeitswelt, die sind alle über mich", sagt sie einmal zu Paul. Dennoch scheint das Paar zusammen mit Johannas von einem früheren Partner gezeugten Sohn am Anfang des Buches auf eine gewisse Art glücklich zu sein. Bis zu dem Moment, in dem der Autor den besten Trick des Campusroman-Altmeisters David Lodge vollführt: nämlich auf einer langweiligen Konferenz eine geheimnisvolle Frau auftauchen zu lassen.
Eigentlich hatte Paul gar nicht zu dieser Konferenz nach Leipzig gewollt. Doch sein väterlicher Professor zwingt ihn, damit er bei der Verwaltung Gründe für die Stellenverlängerung vorweisen kann. Die Tagung über Nachkriegsliteratur, bei der Paul einfach "irgendein altes Kapitel aus seiner komischen Arbeit" referieren soll, wird dann auch bald Nebensache: Denn mit dem Auftritt von Lea, einer Schönheit mit halblangen braunen Haaren, die einen "viel zu großen olivgrünen Armeeparka mit fellbesetzter Kapuze" trägt, erhält die Geschichte ihre Fallhöhe: Aus dem spöttisch-witzigen Universitätsroman wird eine vertrackte Beziehungsgeschichte. Von Liebe zu sprechen wäre hier unangebracht, denn von Gefühlen handelt dieser Roman wenig. Für Paul geht es wohl vielmehr um die Erfahrung, noch ein zusätzliches, geheimes Leben mit Lea in Leipzig beginnen zu können, kaum mehr als eine Zugstunde entfernt von seinem Familienleben in Berlin. In Lea hat er eine ihm noch ähnlichere Partnerin gefunden: Auch sie ist Doktorandin der Literaturwissenschaft, aber vor allem hadert auch sie mit ihrem Thema sowie ihrer gesamten Existenz, ist bedroht vom Niemalsfertigwerden. Ohne dass viel und Genaueres davon erzählt würde, erfährt man außerdem, dass die Beziehung von Paul und Lea vor allem auf Sex gebaut ist.
Beiden Frauen verschweigt Paul die jeweils andere und steuert damit auf die Katastrophe zu. Durch einen weiteren Erzählertrick kann er Lea noch für einen Sommeraufenthalt nach New York folgen, ohne dass Johanna es bemerkt - das verschafft dem Roman, nach einigen interessanten Szenen in Leipziger Altbauten, auch noch einen weltgewandten, um nicht zu sagen: hippen Dreh in die Wohnkaschemmen von Brooklyn, wo Kakerlaken lauern und die Begegnungen hitziger und schwitziger werden.
An vielen Stellen merkt man Sebastian Lehmanns Roman den Lesebühnen-Hintergrund seines Autors an. Das sorgt für meist kurze, auch auf Pointe geschriebene Absätze und Kapitel, ähnlich wie man es etwa zuletzt bei Bov Bjerg gesehen hat. Weniger schlau war es vielleicht, dauernd die Perspektive zu wechseln und so auch die anderen Figuren in der Ich-Form erzählen zu lassen - das hat einen gewissen Baukasten-Effekt.
An den besten Stellen weicht der Witz einem wenn auch ironisch verbrämten, so doch ernsten Blick auf die Sekundärexistenz von Literaturwissenschaftlern im Vergleich zu den Literaten selbst: "Wir sind nur zu Besuch, wir sind der Gast, der bis zum Ende der Party bleibt - und noch darüber hinaus, denn niemand schmeißt uns hinaus in die kalte Nacht der Realität. Wir sind wahrscheinlich noch viel größere Phantasten als die Schriftsteller!", heißt es einmal.
Wenn das Genre "Campusroman" mehr will, als nur Unterhaltung oder Liebelei in universitärem Setting zu bieten, dann kann dies in der plausiblen Verflechtung der Forschungsgegenstände der Figuren mit deren Leben gelingen. Dass hier diese Gegenstände vor allem in altbekannten Weisheiten aus Max Frischs Romanen "Stiller" und "Mein Name sei Gantenbein" bestehen, gibt dem Roman eine weitere Fallhöhe; er ist, böse gesagt und im Vergleich etwa zu Mathias Énards "Kompass", der in der Verflechtung von Wissenschaft und Leben ungeheure Tiefe erreicht, eine Art Campusroman für Anfänger. Aber das ist in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur schon eine große Errungenschaft.
Attila Bartis: "Das Ende".
Roman.
Aus dem Ungarischen von Terézia Mora. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 751 S., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH