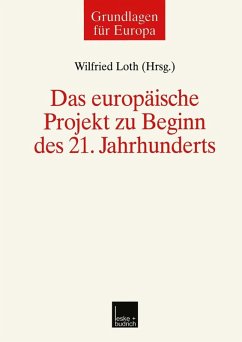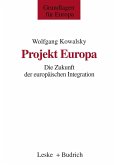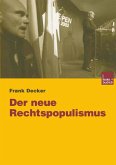Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Europäische Union in Vergangenheit und Zukunft
Wilfried Loth (Herausgeber): Das europäische Projekt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Verlag Leske und Budrich, Leverkusen 2001. 392 Seiten, 24,90 Euro.
Bisweilen ist es nützlich, bei allem Nachdenken über die finale Gestalt Europas gelegentlich die Fragen zu stellen: Welche Motive und Initiativen haben dem Einigungsprozeß die entscheidenden Impulse verliehen? Welche Lehren lassen sich daraus für die künftige Entwicklung ziehen? Dies ist die Absicht des Sammelbandes. Allerdings ist der Band im ersten Teil eine Bündelung von historischen Analysen, die aneinandergereiht werden, ohne daß ein annähernd erschöpfender perspektivischer Ausblick auf den zweiten Teil geliefert wird.
Im zweiten Teil überzeugt die Auswahl der Themen bei dem Versuch, das gegenwärtige Ringen der Europäischen Union um ihre Umgestaltung zu analysieren. Jedoch vermißt der Leser stellenweise den Bezug zu der Grundthese des Herausgebers Wilfried Loth, wonach Erweiterung und Vertiefung als dialektischer Prozeß zu begreifen seien; eine Aufschiebung der Erweiterung mit dem Hinweis auf zuvor notwendige institutionelle Reformen sei längst nicht mehr möglich; die Ost-Erweiterung sei ein irreversibler Prozeß. Umgekehrt lasse sich die anstehende größte Erweiterungsrunde in der Geschichte der Gemeinschaft nicht ohne Stärkung ihrer Strukturen vollziehen.
Beide Prozesse hängen eng mit der Frage nach der Identität und den Grenzen Europas zusammen, wie der Beitrag von Sabine Voglrieder zeigt. Je nach Blickwinkel werden historisch-kulturelle, sozioökonomische oder politisch-institutionelle Faktoren als "identitätsstiftend" in Europa angesehen. Eine eindeutige Begriffsbestimmung ist zwar nicht möglich, dennoch gibt es eine Tendenz, wonach die "westlich-lateinisch" geprägte Identität der großen Mehrheit der Mitgliedsländer "den grundlegenden Interpretationsrahmen" für die Prüfung der politischen und wirtschaftlichen Beitrittsfähigkeit der Kandidaten bildet. Dies scheint vor dem Hintergrund einer immer attraktiver und größer werdenden Union plausibel und notwendig zugleich. Das ausschließliche Pochen und Hinwirken der EU auf die Erfüllung politisch-institutioneller und ökonomischer Kriterien reicht für ein Organisationsmodell, das eindeutig Merkmale von Staatlichkeit aufweist, nicht mehr aus. Ansonsten würde die Diskussion um die Grenzen Europas ad infinitum geführt.
Unabhängig von der Frage, wie weit die Union einmal reichen soll, gilt schon jetzt, daß das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit, wie es mittlerweile in den Verträgen verankert ist, eine richtige Antwort auf die erweiterte Union ist. Andernfalls würden die integrationswilligen Staaten zunehmend dazu gedrängt, ihre Zusammenarbeit außerhalb der Gemeinschaft zu organisieren. Die Bedingungen, die an die Institutionalisierung einer solchen Zusammenarbeit gestellt werden, sind allerdings nach wie vor so eng gefaßt, daß diese sich bisher als eher stumpfes Instrument erwiesen hat. Mit anderen Worten: Gerade in einer erweiterten Union sollte die verstärkte Zusammenarbeit zwar auf der Tagesordnung bleiben, sie darf aber - wie bislang - nicht nur als letztes Mittel nach ergebnislosem Ablauf des "normalen Verfahrens" in Betracht kommen.
Das gilt besonders für den Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), auch wenn jede Flexibilisierung auf diesem Feld in dem Beitrag von Johannes Varwick geradezu als "Bedrohung" für eine weitere Vergemeinschaftung stilisiert wird. Selbst wenn man die Nato - richtigerweise - weiterhin als stabilste und handlungsfähigste Institution innerhalb der europäischen Sicherheitsstruktur betrachtet, dürften die möglichen künftige Konfliktszenarien es erforderlich machen, von Fall zu Fall eine eigenständigere europäische Streitkraft zur Verfügung zu haben - gleichgültig, ob innerhalb oder außerhalb der Nato. Angesichts des vielzitierten mangelnden politischen Willens der Mitgliedstaaten, dies anzuerkennen, dürfte das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit durchaus nützlich sein.
Dennoch hat der Vertrag von Nizza in diesem Punkt noch keinen entscheidenden Durchbruch erzielt. Verstärkte Zusammenarbeit kann zwar nun in den Bereichen des EG-Vertrages und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Im Bereich der GASP bleibt aber Einstimmigkeit weiterhin erforderlich. Im übrigen ist der Anreiz für handlungswillige Staaten aufgrund der technischen Hürden (Sperrminorität, Mitkonsultierungspflicht gegenüber den ausgeschlossenen Staaten, Mitentscheidungskompetenz des Parlaments et cetera) deutlich begrenzt.
Viel wichtiger bleibt die Daueraufgabe weiterer institutioneller Reformen. Zwar haben die Staats- und Regierungschefs in Nizza grundsätzlich die institutionellen Voraussetzungen für die Ost-Erweiterung der EU geschaffen. Hinsichtlich der klassischen Handlungsfelder der Union und ihres Ausbaus ist die Effektivität der Entscheidungsprozesse aber kaum größer geworden. Heftige Verteilungskämpfe auf den Gebieten der Agrar- und Strukturpolitik sind weiter vorprogrammiert. Hinzu kommt, daß Zahl und Variationsbreite der Entscheidungsverfahren sogar zugenommen haben und damit auch nicht transparenter geworden sind. Schade, daß das Thema "institutionelle Reformen" in dem Band lediglich im abschließenden Kapitel des Herausgebers so kurz behandelt wird; es hätte nach Anspruch des Bandes eigentlich größere Aufmerksamkeit finden müssen.
STEFAN FRÖHLICH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main