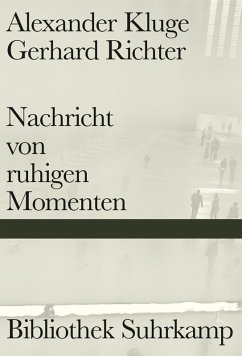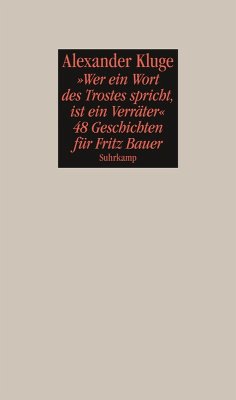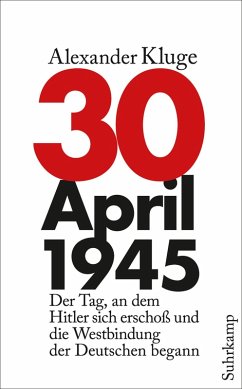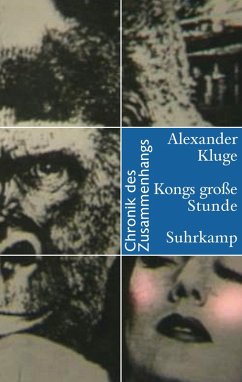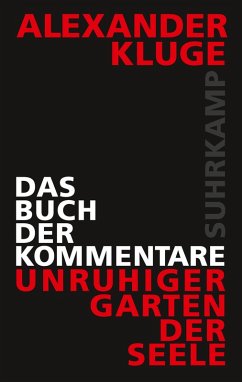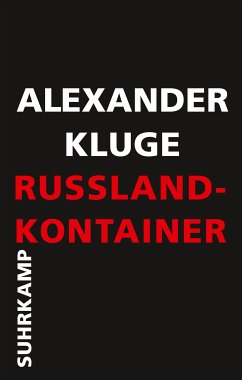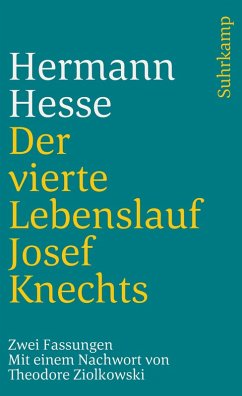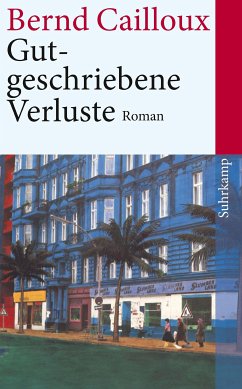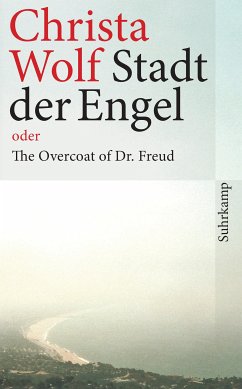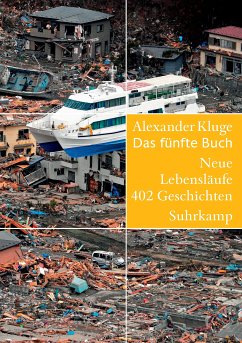
Das fünfte Buch (eBook, ePUB)
Neue Lebensläufe. 402 Geschichten
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 42,00 €**
36,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Buch mit Leinen-Einband)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Unsere Lebensläufe sind die Häuser, aus deren Fenstern wir Menschen die Welt deuten: ein Gefäß der Erfahrung für das literarisch Erzählbare.« Alexander Kluge Mit diesem Fünften Buch gelangt Alexander Kluges großes Erzählprojekt zu seinem Abschluß. In vier voraufgegangenen Bänden, der zweibändigen »Chronik der Gefühle« und den einbändigen Geschichtensammlungen »Die Lücke, die der Teufel läßt« sowie »Tür an Tür mit einem anderen Leben«, wurden seit dem Jahr 2000 die über sechs Jahrzehnte hinweg entstandenen Geschichten des Autors in großformatigen Bänden versammelt...
»Unsere Lebensläufe sind die Häuser, aus deren Fenstern wir Menschen die Welt deuten: ein Gefäß der Erfahrung für das literarisch Erzählbare.« Alexander Kluge Mit diesem Fünften Buch gelangt Alexander Kluges großes Erzählprojekt zu seinem Abschluß. In vier voraufgegangenen Bänden, der zweibändigen »Chronik der Gefühle« und den einbändigen Geschichtensammlungen »Die Lücke, die der Teufel läßt« sowie »Tür an Tür mit einem anderen Leben«, wurden seit dem Jahr 2000 die über sechs Jahrzehnte hinweg entstandenen Geschichten des Autors in großformatigen Bänden versammelt. Alle Geschichten, die darin nicht enthalten waren, werden diesem Eckband seines Lebenswerks nun auf neue Weise eingeschrieben: konzentriert und endgültig. Darüber hinaus aber führt »«Das fünfte Buch mit einer großen Gruppe »Neuer Lebensläufe« auf den Beginn von Kluges Laufbahn als Erzähler zurück. Seine »Lebensläufe« erschienen 1962, vor genau 50 Jahren. Und wieder nutzt dieser Erzähler sein bewährtes Gefäß: den »Lebenslauf« als das Gefäß aller Erfahrung - für Abgründe der Vernunft, für Brückenköpfe zu offenen Horizonten, für die realistisch-antirealistische Doppelnatur des Menschen und den inneren Partisanen in jedem von uns.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.