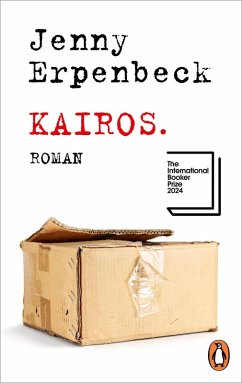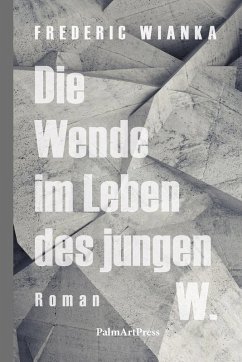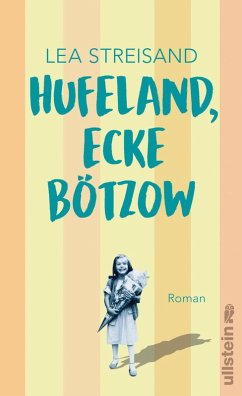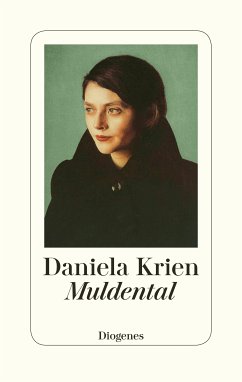Das Gift der Biene (eBook, ePUB)
Roman
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ostberlin, Mitte der 1990er: Endlich ist Christina angekommen in der Stadt ihrer Träume. Berlin nach dem Mauerfall, das ist für die junge Amerikanerin die Verheißung, der Ort der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie kann es kaum erwarten, die Geheimnisse dieser so lange verborgenen Stadt und ihrer Bewohner zu ergründen, und sie will dabei die abgelegenen Pfade betreten. Sie zieht in eine Hausgemeinschaft in einem ehemals besetzten Haus, wo die Lebenskünstlerin Meta einen Salon betreibt. Abend für Abend sitzen dort die früheren Hausbesetzer zusammen und diskutieren über die neugewonnene Fre...
Ostberlin, Mitte der 1990er: Endlich ist Christina angekommen in der Stadt ihrer Träume. Berlin nach dem Mauerfall, das ist für die junge Amerikanerin die Verheißung, der Ort der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie kann es kaum erwarten, die Geheimnisse dieser so lange verborgenen Stadt und ihrer Bewohner zu ergründen, und sie will dabei die abgelegenen Pfade betreten. Sie zieht in eine Hausgemeinschaft in einem ehemals besetzten Haus, wo die Lebenskünstlerin Meta einen Salon betreibt. Abend für Abend sitzen dort die früheren Hausbesetzer zusammen und diskutieren über die neugewonnene Freiheit, über die Abgründe des Kapitalismus und den untergehenden Sozialismus: die ehemalige Schauspielerin und Kadersozialistin Karla etwa, oder Wolfgang, der ehemalige Grenzsoldat, in den sich Christina verliebt. Für sie ist die junge Hausgemeinschaft die Verwirklichung einer sozialistischen Utopie, und sie saugt die Gespräche begierig auf. Doch als die rätselhafte, unnahbare Malerin Vera Grünberg in den obersten Stock einzieht, gerät die Utopie ins Wanken. Denn in Vera vermuten die anderen die mögliche Besitzerin des Hauses, geradezu obsessiv spürt Meta dem Gerücht nach, vor dem Krieg habe im Gartenhaus ein Wunderrabbi namens Grynberg gelebt. Und dann kommt es tatsächlich zu einem Wunder... "Isabel Fargo Cole pflegt einen elegischen, versonnenen Stil, der Seltenheitswert hat." Katrin Hillgruber, Deutschlandfunk Büchermarkt
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.