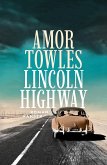Die große Finsternis
Rupert und Robert, Freunde und durch den Freitod von Ruperts Mutter auch Ziehbrüder, machen sich auf die Suche nach Ana, Ruperts Freundin. Sie wollen sie im Iran suchen, bei ihrer Mutter.
Mag sein, dass es an mir liegt, nicht am Hörbuch oder Autor. Aber ich stehe völlig
ratlos da, frage mich, was Andreas Stichmann mit diesem Werk sagen will. Ich mag keine der Figuren,…mehrDie große Finsternis
Rupert und Robert, Freunde und durch den Freitod von Ruperts Mutter auch Ziehbrüder, machen sich auf die Suche nach Ana, Ruperts Freundin. Sie wollen sie im Iran suchen, bei ihrer Mutter.
Mag sein, dass es an mir liegt, nicht am Hörbuch oder Autor. Aber ich stehe völlig ratlos da, frage mich, was Andreas Stichmann mit diesem Werk sagen will. Ich mag keine der Figuren, hätte im wahren Leben mit nicht einer der Personen auch nur fünf Minuten verbracht. Absolut nicht meine Welt – schon gar nicht die Pseudo-Sexfilmchen, die „lustigen“ Diebeszüge oder sonstige irren Aktionen dieser völlig frustrierten, leblosen, interesselosen jungen Menschen, die nur an sich selbst denken, aber nicht an andere. Das ändert sich auch nicht, als Rupert Mitleid mit einem Huhn entwickelt.
Alles ist so sinnlos und dämlich, wie die Einstellung der Figuren. Kein Wunder, dass ich da keinen Zugang finde. Nur aufregen muss ich mich ständig. Szenen, die einzeln gesehen möglicherweise in jedem Leben eines Jugendlichen geschehen können, aber alle zusammen? Ein wenig stark übertrieben, möchte ich meinen – und hoffen. Philosophie konnte ich hier keine finden, auch nicht mit noch so viel Mühe. Dafür aber eine Menge Erzählstränge, die mehr oder weniger durcheinanderlaufen und nur bedingt zum großen Ganzen beitragen. Dass Ruperts Leben nicht schön und behütet war, das sehe ich ja ein. Dennoch muss man nicht so werden, wie er. Im Gegenteil: gerade dann sollte man alles daran setzen, ein normales, schönes Leben aufbauen zu können. Den Flug und den Aufenthalt im Iran konnten sie sich ja auch wohl nur durch die Überfälle und Diebstähle finanzieren – schon da hört es bei mir auf.
Mich hat das (Hör-)Buch sehr ärgerlich gemacht. Wütend. Da gibt es so viele gute (Hör-)Bücher und ich verliere Hör-/Lesezeit mit so einem Krampf. Keine Empfehlung, kein Lob, nur der Pflichtstern.