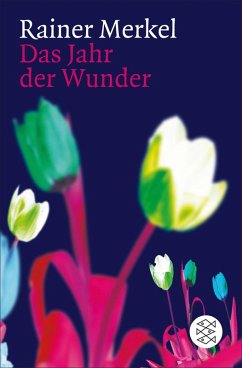Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Rainer Merkels Debüt aus der Werbewelt · Von Tilman Spreckelsen
Es muß schwierig sein, so zu leben wie Christian Schlier. Der Medizinstudent, der durch eine Prüfung gefallen ist und sich jetzt in einer Werbeagentur bewirbt, neigt dazu, sich permanent zu beobachten, seine Reaktionen auf die Umwelt zu analysieren und vor allem zu kritisieren: "Vielleicht ist es ein Fehler, daß ich das Essen nicht genieße", überlegt er, oder er stellt fest: "Ich bin locker, entspannt, ich versuche übermütig zu sein." Denn seine Bemühungen, die eigenen Verhaltensweisen zu kontrollieren, erstrecken sich auch auf Bereiche, die sich gerade dadurch definieren, daß sie nicht zu kontrollieren sind: "Ich sagte mir: Ich muß leidenschaftlich sein. Oder: Ich muß noch leidenschaftlicher sein. Sonja lachte mich aus." Daß sich Christian und Sonja in Rainer Merkels Debütroman "Das Jahr der Wunder" bald darauf trennen, macht die Sache nicht besser. Christians autosuggestive Obsessionen werden schließlich zur Gewohnheit: "Ich mache die Augen zu. Du mußt nur dran glauben, sage ich. Du mußt daran glauben, daß es gelingt."
Das klingt nach der "Sei-Spontan-Paradoxie" aus Paul Watzlawicks "Anleitung zum Unglücklichsein". Die Aufforderung "sei spontan!" - bei Watzlawick verlangt eine Frau von ihrem Mann, er solle sie doch einmal "spontan zum Essen einladen" - bringt den Adressaten in eine unlösbare Situation: Versucht er, der Aufforderung nachzukommen, läuft ihr sein Verhalten gerade zuwider, denn er handelt ja vorsätzlich und nicht spontan. Im Unterschied zu dem Paar aus Watzlawicks Fallbeispiel braucht Christian allerdings kein Gegenüber, um sich in diese Situation zu manövrieren: "Ich hätte mich jetzt vorbeugen, jetzt meine Hände oder gleich meinen ganzen Oberkörper auf den Tisch legen müssen, mich in dem Zwischenraum, in einer Lücke ihrer langen rhetorischen Wendung einnisten müssen."
Christian erlebt sein Wunderjahr von Herbst 1994 bis Spätsommer 1995, als er in einer Werbeagentur mit dem rätselhaften Namen "GFPD" auf Honorarbasis an einem Projekt arbeitet und sich immer stärker in den Sog dieser Tätigkeit begibt, jeden Tag in den Räumen der Agentur verbringt und vor lauter Ideen die Adressaten seines Projekts, eine schwäbische Bausparkasse, gründlich aus den Augen verliert.
Immer wieder kommen ihm Lesefrüchte in die Quere, die seine Perspektive einfärben und in einer bunten Mischung von Borges über Lem bis Saint-Exupéry reichen. Allerdings werden die Bücher so gut wie nie korrekt zitiert, im Gegenteil: Fast überdeutlich führt der Autor vor, daß sich seine Figur in keinem literarisch versierten Umfeld bewegt, daß Christian ohne Anzeichen von Erstaunen Stephen Hawking als Autor der "Recherche" akzeptiert oder ein Haiku mit nur fünfzehn Silben. Seine eigene Lektüre entstammt vor allem dem Feld der Jugendliteratur, der "Drei-Fragezeichen"-Serie oder dem Kosmos Enid Blytons: "Wosch ist lässig, jungenhaft, entspannt. Er erinnert mich an eine Figur aus einem Enid-Blyton-Roman, den ich als Kind gelesen habe, einen Jungen, der sich mit seinen Freunden in einer Höhle versteckt, während die Verbrecher in den Tiefen des Berges herumirren, um einen Schatz zu finden, der ihnen nicht gehört" - offenbar denkt er an Philip Mannering aus Blytons "Das Tal der Abenteuer". Wenig später strahlt Wosch den neuen Mitarbeiter der Agentur "an, als würden wir in diesem Moment aus einem dunklen Tunnel treten und die ,Insel der Abenteuer', die Geschichte der fünf Freunde, fängt an."
Das Konglomerat aus zwei Einzelbänden und - mit den "Fünf Freunden" - einer ganzen Buchreihe, auf die kurz hintereinander verwiesen wird, dient nicht nur dazu, die Erinnerung des Erzählers als wenig präzise zu kennzeichnen (will man nicht unterstellen, daß statt der Figur der Autor "Das Tal der Abenteuer" mit "Die Insel der Abenteuer" verwechsele oder sogar der "Fünf Freunde"-Serie zuschlage). Es steckt auch den Rahmen ab, in dem sich Christians interpretierende Phantasie bewegt: In seiner Vorstellung ist die Agentur Teil des Blyton-Universums, in dem Jugendgruppen fernab der Erwachsenen ihre Abenteuer erleben, selbständig, aber ohne wirkliche Verantwortung; am Ende bleibt alles Spiel. Daß sich diese Perspektive aufs schönste mit seiner Arbeit als "Kreativer" verbinden läßt, ist Christians feste Überzeugung: "Ich sage Grassi, daß ich glaube, daß wir so tun müssen, als seien wir selbst noch für Sekunden Jugendliche, als seien wir selbst Kinder."
Zum Gruppenabenteuer gehört nicht nur, daß man sich untereinander duzt und die wahren Hierachien verschleiert, sondern auch der prinzipielle Mangel an Gewißheiten über Termine, Entlohnung und Perspektiven jedes einzelnen. Für Christian werden die Dinge bald "auf interessante Weise immer komplizierter und undurchsichtiger". Ausdruck seiner Orientierungslosigkeit ist es, daß sein bevorzugtes Mittel in Konferenzen die Imitation der anderen ist. Er wiederholt Argumente seiner Mitstreiter, indem er sie leicht abwandelt oder als Frage aufgreift, und geht sogar so weit, daß er die Stimme eines Kollegen imitiert: "Und es ist nur eine Stimme gewesen, derer ich mich bedient habe. Ich habe noch zahllose andere Stimmen in mir, und bei nächster Gelegenheit werde ich die Stimmen von Titus, von Beatrice oder von Molberger ausprobieren."
Leider hat Christian als Erzähler nur seine eigene Stimme zur Verfügung, und derer wird man rasch überdrüssig. Es fragt sich, ob es eine glückliche Entscheidung des Autors war, diesen fast dreihundert Seiten langen Roman aus einer deutlich als defizitär gezeichneten Perspektive zu erzählen, einer Perspektive zudem, die kaum einen Wandel durchläuft. So ist es zwar hochinteressant, einer Figur, die unmerklich in einen alles andere absorbierenden Arbeitsrausch gerät, bei ihren Selbstbeschreibungen zuzuhören. Allerdings beschränken sich diese Erklärungen gern auf Sätze wie: "Es ist eine ganz natürliche Entwicklung, daß ich jetzt auch am Wochenende arbeite. Am Anfang dachte ich noch, ich müßte mich ausruhen und sonntags solange wie möglich zu Hause bleiben, aber dann fahre ich doch immer wieder in die Agentur."
Hinzu kommt, daß Christian gern auf verbrauchte Formulierungen zurückgreift oder manchmal alle Präzision zugunsten einer wolkigen Metaphernsprache hintanstellt: "Wosch lächelt mir zu, und wir gleiten, scheinbar willenlos, in einem Zustand der Verflüssigung durch die sich öffnenden, bläulichen Glaswände hindurch." Das gilt auch für Naturschilderungen: "Der Sommer spielte mit uns, umgarnte uns, flirtete mit uns, brannte sich in stundenlanger, sinnloser Glut in unsere Köpfe und schmiegte sich am Abend, leicht errötend, an uns und legte sich zart auf unsere Augen." Auch der Niederschlag kommt eher konventionell daher: "Draußen regnet es. Ein sanftes, kaum merkliches Nieseln, das den Asphalt zum Glänzen bringt", bis schließlich "die Stadt zu einer undeutlichen Neonlandschaft verschwimmt, die an ihren Rändern dunkel und schläfrig ist". Manchmal steigt "die Aura des Verschwenderischen unmittelbar vor uns mühsam gebändigt aus der Motorhaube", oder Christian läßt "den Tag noch einmal Revue passieren". Wenn die Sonne scheint, schiebt sie sich "wie eine große, goldene Sichel über die Köpfe der Grafiker bis in den Konferenzraum hinein, wo sie für den Rest des Vormittags auf einem halbkreisförmigen Areal verharrt, bis sie sich langsam und unmerklich wieder zurückzieht" - das erstaunt, pflegt sie doch sonst mal hierhin, mal dorthin zu scheinen und ihren Rückzug musikalisch zu untermalen, damit man ihn auch bemerkt.
Nichts in diesem Buch ist geeignet, den Leser zu überraschen, weder die Sprache des Erzählers noch die Charaktere in der Agentur, die tatsächlich genau so sind, wie man sie sich immer vorgestellt hatte. Immerhin ist die Erzählerfigur so schlüssig entworfen wie die Handlung, so daß der Band als handwerklich solides Debüt gelten kann. Aber ein Funke will nicht überspringen.
Rainer Merkel: "Das Jahr der Wunder". Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2001. 282 S., geb., 38,92 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main