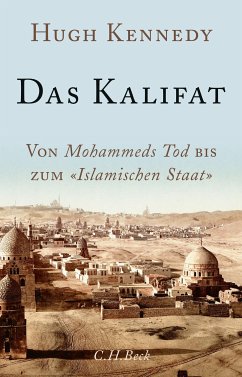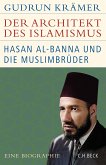Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Soll die Abstammung entscheiden oder eine Wahl? Der Islamwissenschaftler Hugh Kennedy beleuchtet die Historie des Kalifats. Eine Wiederkehr in Gestalt des "Islamischen Staats" passt nicht ins Bild.
Der "Islamische Staat" (IS) ist unlängst aus dem syrischen Raqqa vertrieben worden. Damit hat er die letzte ihm verbliebene städtische Bastion verloren, nachdem er zuvor nach langen Kämpfen schon seine wichtigste irakische Basis, Mossul, hatte aufgeben müssen. Besiegt ist dieses "neue Kalifat", das vor drei Jahren proklamiert worden war, indes noch nicht, doch dürfte seine Anziehungskraft durch die jüngsten militärischen Niederlagen und territorialen Verluste ziemlich gelitten haben.
Gleichwohl ist die Idee eines islamischen Kalifats nicht tot. Das nahöstliche Staatensystem, vor hundert Jahren durch westliche Mächte entworfen, droht zu implodieren. Die arabischen Nationalstaaten in dieser Region waren seither nicht besonders erfolgreich bei der Bewältigung wichtiger Probleme ihrer Bevölkerungen, zumal ihre Konzepte zu weiten Teilen dem europäischen politischen Denken entlehnt waren. Es war ein Import aus dem Westen.
Der Londoner Islamwissenschaftler Hugh Kennedy verfolgt in seinem neuen Buch die Geschichte des Kalifats von Mohammeds Tod bis zum "Islamischen Staat". Sogleich nach Mohammeds Tod stellten sich jene Fragen, die zu dem "Modell" des Kalifats führten: Wer soll Gottes Statthalter nach des Propheten Tod sein und wer Mohammeds Nachfolger (chalifa)? Damit verbunden war die Frage nach der prinzipiellen Struktur der Gemeinschaft der Muslime. Wer sollte herrschen, und wie sollte man sich organisieren? Sollte man den Nachfolger wählen, oder sollte das Prinzip der Abstammung zum Tragen kommen?
Früh kam die Vorstellung auf, der Kalif müsse aus dem großen Stamm der Quraisch (Koreischiten) hervorgehen wie der Prophet Mohammed selbst. Bis heute sind Fragen der - auch im weitesten Sinne religiös definierten - Legitimität in der islamischen Welt von großer Brisanz. Noch in den neunziger Jahren stritten arabische Führer darüber, wer von ihnen qua Abkunft und religiöser Tradition zur Herrschaft am besten legitimiert sei.
Nachdem die ersten Kalifen, die man als die Rechtgeleiteten (raschidun) bezeichnet, von einer Schura gewählt worden waren, wurde das Prinzip der Abstammung immer wichtiger, ging am Ende in ein dynastisches Prinzip (allerdings ohne Primogenitur) über. Besonders wichtig war dies für die Partei der Schiiten, die Anhänger Ali Ibn Abi Talibs, des leiblichen Vetters und Schwiegersohnes des Propheten, der nach Auffassung seiner Anhänger, der Aliden, von der sunnitischen Mehrheit um die Herrschaft betrogen worden war. Die Ermordung Alis im Jahr 661 sowie seines Sohnes Hussein im Jahr 680 machte die Spaltung in Schiiten und Sunniten endgültig. Eine dritte Partei, die extrem egalitären Charidschiten, vertrat die Auffassung, nicht Abstammung oder Wahl allein seien das Kriterium für die Legitimität eines Kalifen, sondern seine Frömmigkeit; der Frömmste müsse herrschen, "und sei er ein schwarzer Sklave". Noch heute gibt es diese kleine Minderheit in Oman, im Süden Algeriens und auf der tunesischen Insel Djerba.
Ausführlich widmet sich Kennedy dann den beiden Kalifaten der Umayyaden (661 bis 750) und Abbasiden (751 bis 1258). Unter ihren Herrschern, für die so bekannte Persönlichkeiten wie Abd al Malik (der Erbauer des Felsendoms zu Jerusalem) oder der "Märchenkalif" Harun al Raschid stehen, erlebte die islamische Zivilisation ihren höchsten Glanz, der bis heute seine Wirkung auf die Muslime in aller Welt nicht verfehlt. Unter beiden Dynastien nahm das Kalifat sozusagen Modellcharakter an, wurden seine Institutionen sowie das islamische Rechtssystem ausgeprägt. Dabei waren beide Kalifate durchaus verschieden.
Das umayyadische Kalifat war arabisch, unter den Abbasiden, die sich auf Abbas, einen Onkel Mohammeds, bezogen, kamen persische und andere Einflüsse hinzu. Vor allem die Frühzeit des Abbasiden-Kalifats gilt vielen Muslimen wie Nichtmuslimen als Höhepunkt der Kalifats-Geschichte. Die materielle Kultur blühte, geistig herrschte ein großer Pluralismus der Meinungen in Dichtung, Philosophie und Theologie. Angesichts dieser Charakterisierung muten heutige historische Bezüge des IS auf die Abbasiden geradezu grotesk an.
Aus der Verfallsgeschichte der Abbasiden, die Kennedy ausführlich dokumentiert, erwuchsen separate Herrschaften, die islamische Welt zersplitterte sich mehr und mehr. Ein beständiger Rivale war zuvor schon das Umayyaden-Kalifat zu Córdoba (929 bis 1031), von dessen Herrschaft bis heute ebenfalls viel Glanz ausgeht. Auch dieses Kalifat erlebte seinen Verfall, die nachfolgenden westlich-nordafrikanisch-spanischen Kalifate waren durch wachsenden Rigorismus gekennzeichnet, etwa das der Almohaden (1130 bis 1269), denen es immerhin gelang, die Fragmentierung unter den Reyes de Taifas, den muslimischen Klein- und Minifürstentümern Spaniens, kurzfristig zu beseitigen.
Neben den sunnitischen Kalifaten behandelt der Autor auch die schiitische Kalifats-Tradition, die ihre wirkmächtigste Ausprägung im ismailitischen Kalifat der Fatimiden (909 bis 1171) in Ägypten fand. Wie durchlässig deren Herrschaft war, wird aus der Tatsache deutlich, dass die Bevölkerung sunnitisch blieb, und bis heute ist Ägypten ein sunnitisches Land. Auch der Anteil der christlichen Bevölkerung blieb unter den Fatimiden erstaunlich groß. Unter den nachfolgenden Mamluken lebten Angehörige des im Mongolensturm untergegangenen abbasidischen Kalifats, von denen die türkischen Osmanen später eine Art "Filiation" übernahmen, als deren Sultan Selim I. 1517 Ägypten eroberte.
Es ist wohl, wie Kennedy schreibt, eine Legende, dass der letzte Abbaside Mutawakkil in Kairo dem osmanischen Eroberer die Kalifen-Würde übertragen habe. Das zwischen 1299 und 1922 existierende Osmanische Reich wurde schließlich das letzte Kalifat, es herrschte zwischenzeitlich auf drei Kontinenten, wurde im Jahre 1923 durch die von Mustafa Kemal Atatürk gegründete Republik ersetzt. Atatürk schickte den letzten osmanischen Kalifen, Abdülmecid II., der seit 1922, als bereits das Sultanat beseitigt worden war, nur noch symbolisch seines Amtes gewaltet hatte, 1924 ins Exil und erklärte das Kalifat für abgeschafft.
Wie stark Idee und Wirklichkeit des Kalifats als Herrschafts- und Staatsform des Islams noch waren, zeigte die Kalifats-Bewegung der Muslime auf dem indischen Subkontinent. Die dortigen Muslime wünschten damals, dass Kemal Atatürk sich zum Kalifen erkläre. Davon konnte keine Rede sein. Dann schlug ohnehin die Stunde von Nationalismus und etlichen Spielarten des Sozialismus, nach deren Scheitern der Islamismus mächtiger wurde. Die unverhoffte Wiederkehr eines "Kalifats" in Gestalt des mörderischen IS erscheint nach den differenzierten Untersuchungen des Autors als nichts anderes als die "Kaperung einer Tradition", die um der Macht willen ausgenutzt und verbogen wird. Diese Taktik ist nach seiner Auffassung brandgefährlich, nicht die Idee des Kalifats an sich.
WOLFGANG GÜNTER LERCH
Hugh Kennedy: "Das Kalifat". Von Mohammeds Tod bis zum "Islamischen Staat".
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff. C. H. Beck Verlag,
München 2017. 367 S., Abb., geb., 28.- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Michael Rohschürmann, portal politikwissenschaft, 17. November 2017