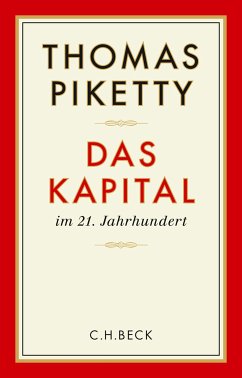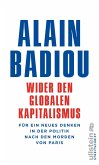Wie entstehen die Akkumulation und die Distribution von Kapital? Welche Dynamiken sind dafür maßgeblich? Fragen der langfristigen Evolution von Ungleichheit, der Konzentration von Wohlstand in wenigen Händen und nach den Chancen für ökonomisches Wachstum bilden den Kern der Politischen Ökonomie. Aber befriedigende Antworten darauf gab es bislang kaum, weil aussagekräftige Daten und eine überzeugende Theorie fehlten. In Das Kapital im 21. Jahrhundert analysiert Thomas Piketty ein beeindruckendes Datenmaterial aus 20 Ländern, zurückgehend bis ins 18. Jahrhundert, um auf dieser Basis die entscheidenden ökonomischen und sozialen Abläufe freizulegen. Seine Ergebnisse stellen die Debatte auf eine neue Grundlage und definieren zugleich die Agenda für das künftige Nachdenken über Wohlstand und Ungleichheit. Piketty zeigt uns, dass das ökonomische Wachstum in der Moderne und die Verbreitung des Wissens es uns ermöglicht haben, den Ungleichheiten in jenem apokalyptischen Ausmaß zu entgehen, das Karl Marx prophezeit hatte. Aber wir haben die Strukturen von Kapital und Ungleichheit andererseits nicht so tiefgreifend modifiziert, wie es in den prosperierenden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg den Anschein hatte. Der wichtigste Treiber der Ungleichheit - nämlich die Tendenz von Kapitalgewinnen, die Wachstumsrate zu übertreffen - droht heute extreme Ungleichheiten hervorzubringen, die am Ende auch den sozialen Frieden gefährden und unsere demokratischen Werte in Frage stellen. Doch ökonomische Trends sind keine Gottesurteile. Politisches Handeln hat gefährliche Ungleichheiten in der Vergangenheit korrigiert, so Piketty, und kann das auch wieder tun.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.