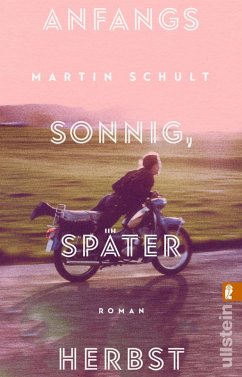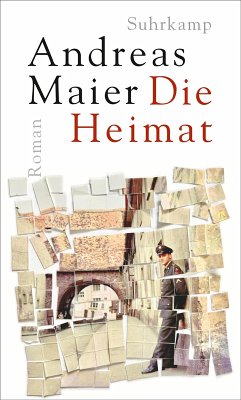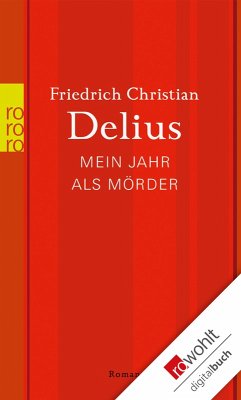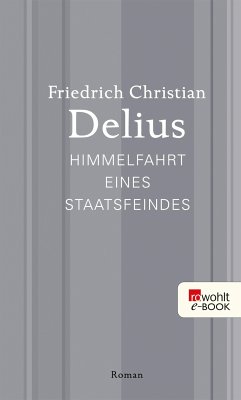»Ein großes Drama, wirklich betörend aufgeschrieben.« Stern, 11.6.2015 »Wildenhains Absage an vorschnelle und oft bequeme Deutungsmuster, sein Verzicht, den herrschenden Mustern in der Person von Matthias ein anderes entgegenzusetzen, machen sein politisches Verständnis von Literatur aus, sie versetzen seine Leserinnen und Leser in eine produktive Unruhe.« Detlef Grumbach, Deutschlandfunk, 10.6.2015 »Der Autor hält verschiedene Themen geschickt in der Schwebe. Er beschränkt sich nicht auf einen gesellschaftskritischen Blick, sondern erzählt von den Voraussetzungen des Lebens und des Menschseins. Große Themen wie Zufall, Verrat oder Hoffnung verbindet er mit alltagsnahen und poetischen Schilderungen.« Karim Saab, Hannoversche Allgemeine
Zeitung, 31.3.2015 »Wildenhain erzählt, wie zeitgeschichtliche Umstände in die Lebensläufe von Familien ragen. Und mit welchen Folgen. Im "Lächeln der Alligatoren" geht dieses Erzählen so fabelhaft auf wie noch nie, weil die Sprache aus einer unterkühlten, verknappten Sprödigkeit heraus immer wieder ins geradezu Expressionistische explodiert, weil sich kein historischer Lehrfilm daraus entwickelt, sondern die zerborstene, berührende Biografie eines Traumatisierten.« Elmar Krekeler, Die Welt Literarisches Leben, 7.3.2015 »Sein Roman hallt nach, wie der Schuss, der schließlich fällt.« Claudia Seiring, Märkische Oderzeitung, 11.3.2015 »Was ist davon zu halten, wenn ein Stück linksradikaler deutscher Geschichte in eine Familiensaga verpackt ist? Sehr viel, wenn man es so raffiniert wie Michael Wildenhain macht.« Jan Decker, Junge Welt, 12.3.2015 »Das macht den Roman so spannend: Er erzählt ein Stück Zeitgeschichte aus der Sicht derjenigen, die sich nie beteiligt haben und trotzdem mitschuldig sind, und die die Gewalt niemals verstehen.« Ina Westermann, literaturkritik.de, August 2015 »Michael Wildenhain beschränkt sich nicht auf einen gesellschaftskritischen Blick, sondern erzählt von den Voraussetzungen des Lebens und des Menschseins. Große Themen wie Zufall, Schuld, Verrat oder Hoffnung verbindet er mit alltagsnahen und poetischen Schilderungen.« Karim Saab, Märkische Allgemeine Zeitung Journal, 1.3.2015 »"Das Lächeln der Alligatoren" ist wie Martha - gnadenlos, brutal, schön, spannend, irritierend zugleich.« Lea Thies, Bücherjournal, 7.3.2015 »Wer "Das Lächeln der Alligatoren" deuten will, als tatsächliche Empathie verratendes Lächeln, als zähnebleckende Mordlust oder als irgendetwas dazwischen, kommt nicht sehr weit, weil es keine Brücke zwischen zwei derart unterschiedlich strukturierten Systemen von Intelligenz gibt. Selten wurde dies so traurig und trotzdem tröstlich dargestellt wie in diesem Roman.« Tilman Spreckelsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.3.2015 »Wildenhain ist ein Roman gelungen, der Fragen der Gewaltlegitimation neu stellt und die Verstrickung von Privatem und Politischem erzählerisch veranschaulicht.« Rainer Moritz, Deutschlandradio Kultur, 3.3.2015 »Eine große Liebesgeschichte, eine kleine Verbrechensgeschichte und eine langwierige Familiengeschichte. ... Klug gebaut und atmosphärisch stark.« Elke Schmitter, Kulturspiegel, März 2015 »Der Roman schafft ein lebendiges Bild eines Deutschland in den 70er Jahren zu entwerfen und die immer noch aktuelle Frage nach Schuld und Gewalt geschickt zu stellen.« Carina Fron, Mephisto 96.7, 19.3.2015 »Kühne Volten, gedrängte Zeitgeschichte, eine literarische Reise ins deutsche Herz der Finsternis. ... "Das Lächeln der Alligatoren" verdichtet auf beeindruckende Weise die verhängnisvolle deutsche Geschichte - und schließt sie mit der privaten Geschichte seines Erzählers kurz.« Thomas André, Spiegel Online, 17.2.2015 »Lakonisch und ohne jede Effekthascherei... Wildenhain versteht es, die Sprache in den Dienst der Handlung zu stellen. Klare Sätze, die in den Momenten der größten Verwirrung des Protagonisten fast ins Stakkato wechseln.« Dimo Riess, Dresdner Neueste Nachrichten, 7./8.3.2015 »Als der Text auf Seite 240 zu Ende war, wünschte ich, er möge weitergehen.« Irmtraut Gutschke, Neues Deutschland, 12.3.2015 »Wildenhain verplottet das Drama der RAF auf die kühnste und gleichzeitig normalste Weise: Es reicht bis in die eigene Familie hinein.« Hamburger Abendblatt, 4.3.2015 »Was für eine Geschichte.« SAX - Das Dresdner Stadtmagazin, September 2015