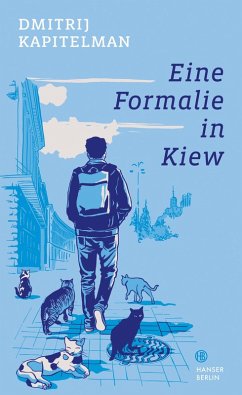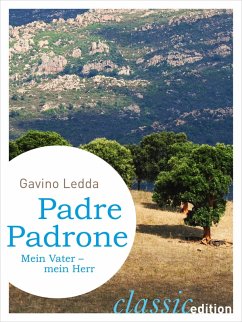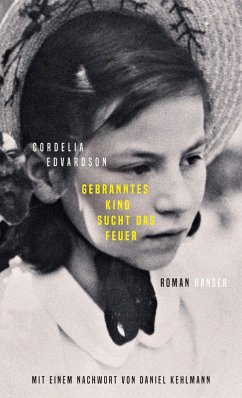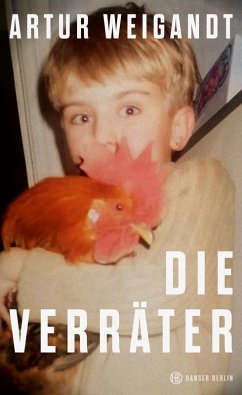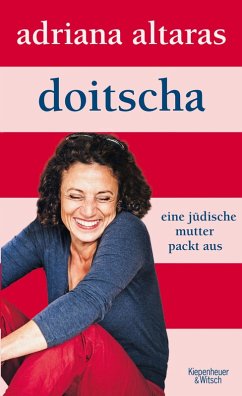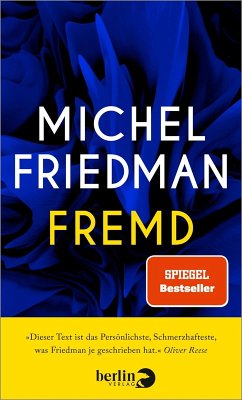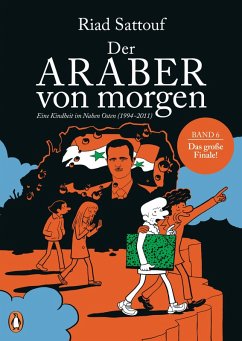Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
13,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Bevor Dmitrij Kapitelman und sein Vater nach Israel aufbrechen, beschränkten sich ihre Ausflüge auf das örtliche Kaufland - damals in den Neunzigern, als sie in einem sächsischen Asylbewerberheim wohnten und man die Nazis noch an den Glatzen erkannte. Heute verkauft der Vater Pelmeni und Krimsekt und ist in Deutschland so wenig heimisch wie zuvor in der Ukraine. Vielleicht, denkt sein Sohn, findet er ja im Heiligen Land Klarheit über seine jüdische Identität. Und er selbst - Kontingentflüchtling, halber Jude, ukrainischer Pass - gleich mit. "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters" ist...
Bevor Dmitrij Kapitelman und sein Vater nach Israel aufbrechen, beschränkten sich ihre Ausflüge auf das örtliche Kaufland - damals in den Neunzigern, als sie in einem sächsischen Asylbewerberheim wohnten und man die Nazis noch an den Glatzen erkannte. Heute verkauft der Vater Pelmeni und Krimsekt und ist in Deutschland so wenig heimisch wie zuvor in der Ukraine. Vielleicht, denkt sein Sohn, findet er ja im Heiligen Land Klarheit über seine jüdische Identität. Und er selbst - Kontingentflüchtling, halber Jude, ukrainischer Pass - gleich mit. "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters" ist ein sehnsuchtsvoll-komischer Spaziergang auf einem Minenfeld der Paradoxien. Und die anrührende Liebeserklärung eines Sohnes an seinen Vater.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.