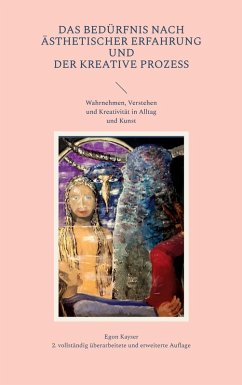Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

W. J. T. Mitchell kokettiert mit der Idee von rätselhaft lebendigen Bildern
Die Erforscher außerirdischen Lebens unterscheiden verschiedene Kommunikationstechniken der Aliens. Die direkteste Form der Kontaktaufnahme - eine "Begegnung der dritten Art" - liegt vor, wenn die Außerirdischen nicht nur Spuren ihrer Existenz hinterlassen, sondern persönlich in Erscheinung treten, um zu zeigen, dass sie es ernst meinen und etwas von uns wollen. Folgt man den Ideen des amerikanischen Kunst- und Literaturwissenschaftlers William J. T. Mitchell, gewinnt man den Eindruck, es komme auch im Umgang mit Bildern zu entsprechenden Begegnungen. Denn die zentrale These seines jetzt auf Deutsch erschienenen Buches "Das Leben der Bilder" besagt, dass auch Bilder durch "Begierden und Sehnsüchte angetrieben" werden, dass sie nach Liebe verlangen und Wünsche haben, kurz: dass sie etwas von uns wollen.
Mitchell verbindet mit dieser Idee ein durchaus ambitioniertes Programm. Die alte Frage nach Macht und Bedeutung der Bilder sei weitgehend erschöpft, heißt es. Statt zu beschreiben, was Bilder bewirken, laute die dringlichere Frage: "Was wollen Bilder?" Mitchells Antwort beginnt mit einer bedenkenswerten Diagnose. Jeder wisse, dass Bilder nicht wirklich lebendig sind, trotzdem behandele man sie oftmals wie belebte Existenzen: Man schreibt ihnen Wirkungen und Einflüsse zu, fühlt sich von ihnen angesprochen oder bedroht und räumt ihnen eine Art von Eigenleben ein. Als drastischen Beleg dieser doppeldeutigen Haltung führt Mitchell das Experiment eines Universitätskollegen an, der seine Studenten regelmäßig auffordert, der Fotografie einer geliebten Person die Augen auszuschneiden. Selbst bei den abgeklärtesten Skeptikern fördert der Versuch offenbar einen Rest von Bildergläubigkeit zutage.
Zu Recht weist Mitchell darauf hin, dass es verfehlt wäre, diese Haltung als Rückfall in archaische Bildpraktiken zu denunzieren. Im Gegenteil hebt er hervor, dass auch moderne Gesellschaften niemals aufgehört haben, an Bilder zu glauben. Der Autor schließt hier unmittelbar an Thesen des französischen Soziologen Bruno Latour an. Nach Latour sind die Bilderstürmer die eigentlichen Ignoranten, da sie die Funktionsweise der Bilder von Grund auf verkennen: Sie glauben fest an die Naivität der Bilderfreunde, die angeblich so einfältig sind, die bildlichen Repräsentationen mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Wenn die Bilder erst einmal zerstört sind, so der Irrtum der Ikonoklasten, ist der Zugang zur Wirklichkeit endlich frei. Ohne Vermittlungen durch Bilder, so Latour, kann es aber gar keinen Weltbezug geben. Je mehr Bilder, desto objektiver der Zugang zur Realität.
Der Vergleich mit den Arbeiten Latours zeigt deutlich, woran es Mitchells Überlegungen mangelt. Latour möchte auch Bildern und Dingen einen Anteil am Zustandekommen von Bedeutung zugestehen. Das erfordert eine symmetrische Beschreibung, die weder Personen noch Dinge verabsolutiert, sondern deren unauflösbares Verflochtensein in den Blick bekommt. Diese Dynamik will Mitchell nicht gelingen. Letztlich findet er nicht aus der üblichen Polarisierung heraus: Entweder erscheint das "Leben der Bilder" als eine rein metaphorische Redeweise, die nicht viel zu bedeuten hat, oder aber der Autor nimmt dieses Leben so wörtlich, dass am Ende ein ungebrochener Animismus herauskommt.
Weitaus problematischer als die kunsthistorisch tradierte Vorstellung vom Eigenleben der Bilder ist eben Mitchells viel weiter gehender Zusatz, dass Bilder einen eigenen Willen besitzen, ihren "Trieben" folgen und "Begierden" haben. So heißt es beispielsweise von einem gemalten Porträt, es warte in seiner abgelegenen Bildergalerie darauf, dass ihm jemand seine Aufmerksamkeit schenkt. Sind Bilder demnach auch nachts aktiv, wenn niemand sie anblickt? Und müssen wir damit rechnen, dass sie sich eines Tages gegen uns verbünden werden?
Irritierend ist, dass Mitchell mit dem animistischen Potential seiner Gedanken eher kokettiert, als es zu reflektieren. An einer Stelle beschreibt er sein methodisches Vorgehen als "Spiel namens Was will das Bild?'". Gegen ein spielerisches Schreiben ist nichts einzuwenden. Mitchells Theoriespiel hat aber nicht selten zur Folge, dass er sich in manchen der Kapitel nicht mehr daran zu erinnern scheint, was er in den vorangegangenen Spielzügen bereits ausgeführt hat. Das führt nicht nur zu eigentümlichen Wiederholungen, sondern auch zu ungelösten Widersprüchen. Tatsächlich ist das Buch keine Monographie, sondern eine Sammlung einzelner Aufsätze, die für verschiedene Anlässe geschrieben wurden. Eine Kuriosität der deutschen Verlagspolitik ist es, dass zwei der Texte vor wenigen Monaten bereits in einer bei Suhrkamp erschienenen Aufsatzsammlung Mitchells publiziert wurden und nun also zum zweiten Mal ins Deutsche übersetzt worden sind.
Seit Mitchell vor fünfzehn Jahren die Formel vom "pictorial turn" geprägt hat, zählt er zu den festen Größen in den Debatten um die Bedeutung der Bilder. Seine Stärke ist es immer gewesen, einen Bildbegriff zu vertreten, der sich nicht im Gestrüpp der Einzeldisziplinen verliert und auch den unproduktiven Wettstreit um die Vorherrschaft von Wort oder Bild nicht mitmacht. In seinem neuen Buch kann Mitchell aber nur mühsam an diese Verdienste anschließen. Enttäuschend sind auch die Bildbeispiele, mit denen die These vom Willen der Bilder illustriert werden soll. Eines davon zeigt das berühmte Propagandaplakat, auf dem Uncle Sam auf den Betrachter zeigt und seinem bohrenden Blick hinzufügt: "I Want YOU." Mit dieser wenig subtilen Ansprache wollte die amerikanische Regierung ihre männlichen Bürger zum Gang ins nächste Rekrutierungsbüro überreden. Aber ist es das, was Bilder von uns wollen?
PETER GEIMER
W. J. T. Mitchell: "Das Leben der Bilder". Eine Theorie der visuellen Kultur. Aus dem Englischen von Achim Eschbach, Anna-Viktoria Eschbach und Mark Halawa. Mit einem Vorwort von Hans Belting. Verlag C. H. Beck, München 2008. 272 S., 58 Abb., br., 16,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main