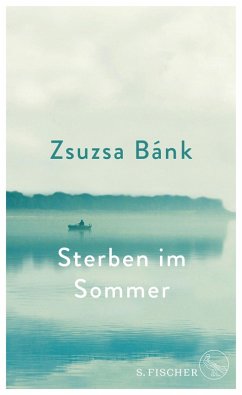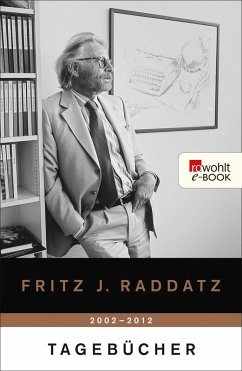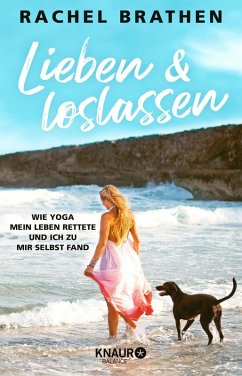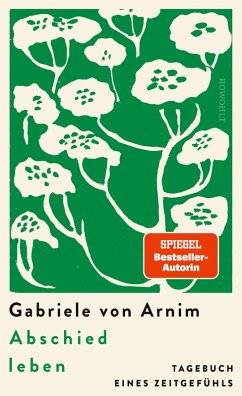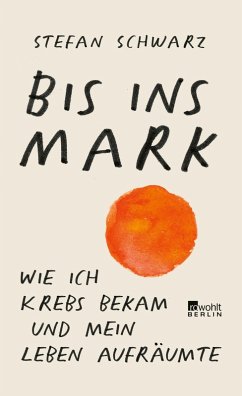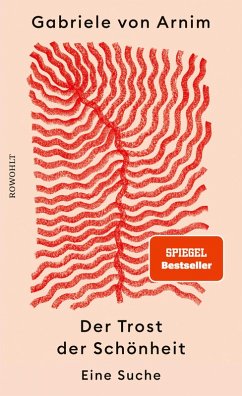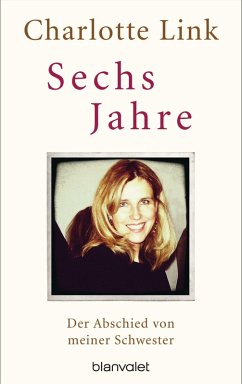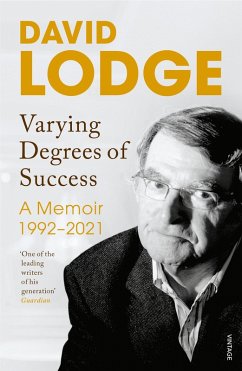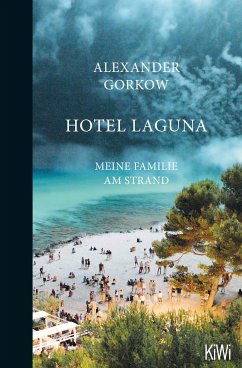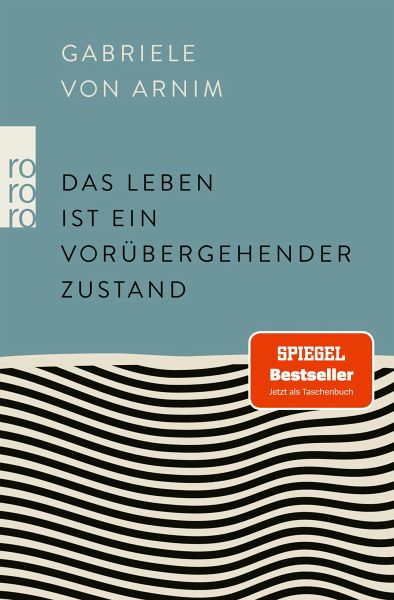
Das Leben ist ein vorübergehender Zustand (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 23,00 €**
10,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Ein erschütterndes Buch, aber es ist eine heilsame, eine befreiende Erschütterung, eine hilfreiche, mit der man deutlich weiter kommt als mit aller wohltuenden Erträglichkeit. [...] im Kern eine Liebesgeschichte - und ein großes Zeugnis." Sten Nadolny Ein Schlaganfall, zehn Tage später der zweite, haben ihren Mann aus allem herauskatapultiert, was er bis dahin gelebt hatte. Und aus ihr wird die Frau des Kranken. Wie liebt und hütet man einen Mann, der an dem Tag zusammenbricht, an dem man ihm gesagt hat, man könne nicht mehr leben mit ihm? Wie schafft man die Balance, in der Krankheit ...
"Ein erschütterndes Buch, aber es ist eine heilsame, eine befreiende Erschütterung, eine hilfreiche, mit der man deutlich weiter kommt als mit aller wohltuenden Erträglichkeit. [...] im Kern eine Liebesgeschichte - und ein großes Zeugnis." Sten Nadolny Ein Schlaganfall, zehn Tage später der zweite, haben ihren Mann aus allem herauskatapultiert, was er bis dahin gelebt hatte. Und aus ihr wird die Frau des Kranken. Wie liebt und hütet man einen Mann, der an dem Tag zusammenbricht, an dem man ihm gesagt hat, man könne nicht mehr leben mit ihm? Wie schafft man die Balance, in der Krankheit zu sein und im Leben zu bleiben? Gabriele von Arnim beschreibt in diesem literarischen Text, wie schmal der Grat ist zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit, Zuwendung und Herrschsucht. Wie leicht Rettungsversuche in demütigender Herabwürdigung enden. Und Aufopferung erbarmungslos wird. "Das Leben ist ein vorübergehender Zustand" ist eine leidenschaftliche, so kühle wie zärtliche Erzählung eines bedrängten Lebens. «Bitte lesen Sie dieses Buch, das mit einer solch stillen Wucht daherkommt, dass man zunächst gar nicht merkt, wie es einen umhaut. Ganz große Kunst und so nah am Leben.» Daniel Schreiber
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.