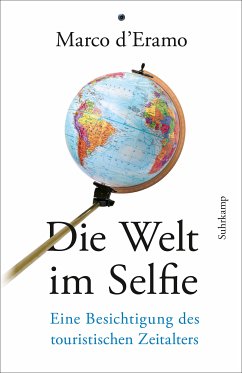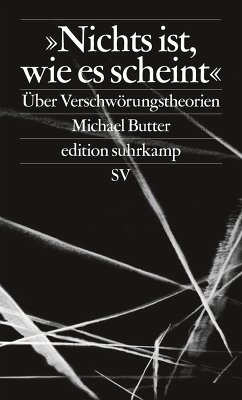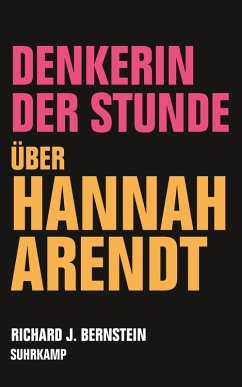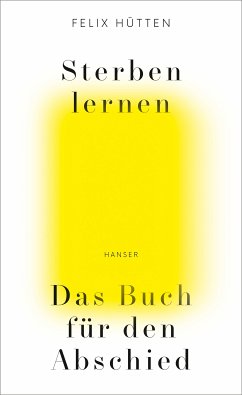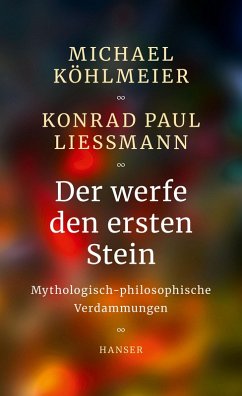Das Leben nehmen (eBook, ePUB)
Suizid in der Moderne
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 34,00 €**
29,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Der Selbstmord«, schrieb Walter Benjamin in seinem Passagen-Werk, erscheint »als die Quintessenz der Moderne«. Und in der Tat: Nachdem der Versuch, sich das Leben zu nehmen, über Jahrhunderte als Sünde oder Ausdruck einer psychischen Krankheit betrachtet, in einigen Ländern sogar strafrechtlich sanktioniert wurde, vollzieht sich seit dem 20. Jahrhundert ein tiefgreifender Wandel, der zur Entstehung einer neuen Sterbekultur beigetragen hat. Der eigene Tod gilt immer häufiger als »Projekt«, das vom Individuum selbst zu gestalten und zu verantworten ist. Wer sich das Leben nimmt, will ...
»Der Selbstmord«, schrieb Walter Benjamin in seinem Passagen-Werk, erscheint »als die Quintessenz der Moderne«. Und in der Tat: Nachdem der Versuch, sich das Leben zu nehmen, über Jahrhunderte als Sünde oder Ausdruck einer psychischen Krankheit betrachtet, in einigen Ländern sogar strafrechtlich sanktioniert wurde, vollzieht sich seit dem 20. Jahrhundert ein tiefgreifender Wandel, der zur Entstehung einer neuen Sterbekultur beigetragen hat. Der eigene Tod gilt immer häufiger als »Projekt«, das vom Individuum selbst zu gestalten und zu verantworten ist. Wer sich das Leben nimmt, will es nicht mehr nur auslöschen, sondern auch ergreifen und ihm neue Bedeutung geben.
Thomas Macho erzählt die facettenreiche Geschichte des Suizids in der Moderne und zeichnet dessen Umwertung in den verschiedensten kulturellen Feldern nach: in der Politik (Suizid als Protest und Attentat), im Recht (Entkriminalisierung des Suizids), in der Medizin (Sterbehilfe) sowie in der Philosophie, der Kunst und den Medien. Er geht zurück zu den kulturellen Wurzeln des Suizids, liest Tagebücher, schaut Filme, betrachtet Kunstwerke, studiert reale Fallgeschichten und zeigt insbesondere, welche Resonanzeffekte sich zwischen den unterschiedlichen Freitodmotiven ergeben. Seine Diagnose: Wir leben in zunehmend suizidfaszinierten Zeiten.
Thomas Macho erzählt die facettenreiche Geschichte des Suizids in der Moderne und zeichnet dessen Umwertung in den verschiedensten kulturellen Feldern nach: in der Politik (Suizid als Protest und Attentat), im Recht (Entkriminalisierung des Suizids), in der Medizin (Sterbehilfe) sowie in der Philosophie, der Kunst und den Medien. Er geht zurück zu den kulturellen Wurzeln des Suizids, liest Tagebücher, schaut Filme, betrachtet Kunstwerke, studiert reale Fallgeschichten und zeigt insbesondere, welche Resonanzeffekte sich zwischen den unterschiedlichen Freitodmotiven ergeben. Seine Diagnose: Wir leben in zunehmend suizidfaszinierten Zeiten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.