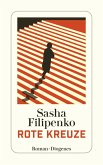Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Woher Selbständigkeit nehmen, wenn man Gehorsam gelernt hat?
Die Schauspielerin
Valery Tscheplanowa legt ein beachtliches Romandebüt vor.
Wenn irgendwo ein Pferd in den Brunnen fällt, bricht irgendwo anders ein neuer Tag an. Dann geht in weiter Ferne die Sonne auf. Beginnt eine nächste Geschichte. Oder wird eine alte Erinnerung wach. Die Szene, der dieser Debütroman seinen Titel verdankt, ist so eindrücklich wie fundamental: In einem alten, stillgelegten Brunnen auf einem Hügel hinter dem sowjetischen Dorf liegt auf dem Grund, verborgen von modrigen Brettern, ein totes Pferd. Angeblich. So erzählt man sich und glaubt es fest. Auch eine junge Frau tut das, Tausende Kilometer von dem Dorf ihrer Großmutter entfernt, in einer Berliner Küche, vor ihr ein Topf mit Grießbrei, in ihr die Erinnerungswehen einer vergangenen Zeit. "Ein Lebewesen, das stark ist und dann zerbrechlich in einem Brunnen liegt, dieses Bild ließ mich nicht los." Das schreibt Valery Tscheplanowa, eine der anziehendsten Theaterschauspielerinnen der Gegenwart. Eine sinneskluge Darstellerin, deren Spiel auf geheimnisvolle Weise unbeeinflusst wirkt von den Abläufen und Forderungen unserer Zeit. Gerade hat man sie noch bei den Salzburger Festspielen gesehen, als wortgenauen "Nathan" in einer Inszenierung von Ulrich Rasche (F.A.Z. vom 31. Juli). Gerade hat man noch mit ihrer Ankündigung gehadert, sich in Zukunft vornehmlich Film und Fernsehen zuzuwenden. Da kommt dieses Buch.
Es erzählt keine zusammenhängende Geschichte und liest sich doch als in einem Stück komponiert. Das Wichtigste in diesem Roman ist die Zeit. Um ihr auf den Zahn zu fühlen, ist er geschrieben. All die berührenden Bilder und behutsamen Worte, mit dem der Text aufwartet, dienen dem einen Ziel: etwas kenntlich zu machen von dem, was sonst unbeobachtet vor sich hin läuft - der Sand in der Uhr, die sich gleich wieder wendet, um ein nächstes Leben zum Verschwinden zu bringen. Dagegen schreibt Tscheplanowa an. Sie hat die Geschichten von vier Frauen in der sowjetischen Provinz miteinander verwoben. Schauplatz ist ein Kurort bei Kasan, in dem schon Stalin Urlaub machte. In ihn kehrt die Protagonistin Walja zurück, um etwas von ihren Prägungen zu verstehen. Ihrem Blick auf die Welt. Woher kommt ihr Gefühl, "niemanden zu brauchen"? Was ist mit dem Holzhaus, in dem die Alte wohnt? Dem bestickten Kissenbezug? Der Stelle, wo der mit Haut umwachsene Knochen auf die Prothese trifft? Lauter Erinnerungssplitter, die zusammengesetzt werden wollen.
Tscheplanowa geht vorsichtig mit den biographischen Zeichen jener vier Frauen um, deren präzise Beziehung zu ihr sie offenlässt. Sie stellt ihr Verschwinden nicht aus, sondern bemüht sich behutsam, ihren verblassten Physiognomien durch poetische Anekdoten aufs Neue Konturen zu verleihen. Mit der Genauigkeit ihrer Beschreibung verleiht sie ihren Leben Würde und Anziehung. Immer wieder ist ihre Achtung vor der Duldsamkeit und Disziplin der Frauen spürbar. Ihre Bewunderung für ihr Durchhaltevermögen in schlechten Zeiten bei zehrender Arbeit. Etwa, wenn sie, die oft Geschminkte und Verkleidete, die Fingernägel einer alten Bäuerin beschreibt: "Die immer noch festen Nägel waren nie zum Lackieren gedacht. Sie haben gepult und durchtrennt, gekratzt und umgegraben."
Unaufdringlich schieben sich Daten der sozialistischen Verfallsgeschichte zwischen die kurzen Erzählabschnitte. Wie 1991 Gorbatschow abgesetzt wurde, wie die Menschen in langen Schlangen für Eier anstanden, wie ein Mann in seiner Siebzig-Quadratmeter-Wohnung trotzig von einer Welt ohne Unterschiede weiterträumt. Vereinzelt bricht sich Bitterkeit Bahn, Verzweiflung über einen Weltgeist, der die Anschauungen einfach so auswechselte, ohne auf die betrogenen Seelen seiner Gläubigen Rücksicht zu nehmen: "Wie eine schützende Decke ist der Kommunismus über ihren Köpfen weggerissen worden, und nun ist Selbständigkeit gefragt. Woher aber Selbständigkeit nehmen, wenn man ein Leben lang Gehorsam gelernt hat?" Das ist für Tscheplanowa keine rhetorische Frage.
Und doch hält die Autorin das Politische auf Distanz, bleibt es im Ungefähren wie hinter einem Gazevorhang. Wichtiger sind ihr die Menschen und ihre Höfe, das, was bestehen bleibt und die Zeitenwenden überdauert: "Es hat sich im Hof nichts getan, während der Sozialismus vorbeizog und ein Kapitalismus für die oberen Zehntausend kam, und trotzdem bleiben die Stufen dieselben.. Ein starkes Vertrauen auf die Präsenz des Wunderbaren durchzieht Tscheplanowas Text. Zum Ausdruck kommt es nicht nur durch die abenteuerliche Reisebeschreibung einer Marien-Ikone, sondern etwa auch in der berührend dichten Beschreibung eines Sterbemoments. Nicht Trauer über den Tod, sondern Staunen über das auslaufende Leben kennzeichnet den Gestus des Schreibens in dieser Passage. Wie überhaupt stolze Erinnerung statt niedergedrückte Sentimentalität dieses besondere Buch bestimmt. Damit hebt es sich deutlich aus der inzwischen fast unüberschaubaren Menge an autobiographisch gefärbten Schauspielerbüchern hervor. Es geht Tscheplanowa nicht darum, ihr eigenes Leben zu erzählen. Gar vor einem deutschen Publikum Zeugnis abzulegen über ihre Herkunft und Heimat. Für Migrations-Voyeurismus ist sie nicht die Richtige. Sie braucht keine kritische Gegenüberstellung zweier Welten, um deutlich zu machen, dass sie sich eine Eigenheit bewahrt hat. Eine Kraft, die von weit her kommt und in ihr weiterlebt. Auf der Bühne, beim Rollenspiel, aber eben überraschenderweise auch in ihrem Schreiben. Nicht selten verwendet Tscheplanowa in ihrem Text die verführerisch romantische Formel des "als ob" - und drückt damit unauffällig ihre Sehnsucht nach einer anderen Zeit und Gefühlswelt aus.
Der Zufall und das zu frühe Ende - darum geht es diesem Buch neben seinen erzählerischen Absichten auch. Ein Kapitel unter der Überschrift "Die Papierheiligen" beginnt mit der Frage, wer der letzte Mensch sein wird, den wir vor unserem Tod sehen. Einer, den man sein Leben lang gekannt hat? Oder einer, der gerade zum ersten Mal ins Zimmer tritt? Es sind diese stillen, unaufdringlichen Grundszenarien menschlichen Fühlens, die "Das Pferd im Brunnen" zu einem außergewöhnlichen Leseerlebnis machen.
In der Schauspielerin Valery Tscheplanowa offenbart sich eine auf ihre Einfühlung stolze Erzählerin. Eine, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zeit "aus den Schubladen" zu befreien, in die sie gezwängt wurde, und von jenem Gefühl zu berichten, wenn "die Tage plötzlich andere Tage geworden sind". Das Vanitas-Motiv tritt hier nicht als bittere Klage auf, sondern als erstaunliche Tatsache. Ein lastloses Wundern durchzieht diesen Roman. Ein Wundern darüber, dass man nicht mehr Zeit miteinander gehabt hat. Nicht ein wenig mehr Zeit. SIMON STRAUSS
Valery Tscheplanowa: "Das Pferd im Brunnen". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2023. 192 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Woher Selbständigkeit nehmen, wenn man Gehorsam gelernt hat?
Die Schauspielerin
Valery Tscheplanowa legt ein beachtliches Romandebüt vor.
Wenn irgendwo ein Pferd in den Brunnen fällt, bricht irgendwo anders ein neuer Tag an. Dann geht in weiter Ferne die Sonne auf. Beginnt eine nächste Geschichte. Oder wird eine alte Erinnerung wach. Die Szene, der dieser Debütroman seinen Titel verdankt, ist so eindrücklich wie fundamental: In einem alten, stillgelegten Brunnen auf einem Hügel hinter dem sowjetischen Dorf liegt auf dem Grund, verborgen von modrigen Brettern, ein totes Pferd. Angeblich. So erzählt man sich und glaubt es fest. Auch eine junge Frau tut das, Tausende Kilometer von dem Dorf ihrer Großmutter entfernt, in einer Berliner Küche, vor ihr ein Topf mit Grießbrei, in ihr die Erinnerungswehen einer vergangenen Zeit. "Ein Lebewesen, das stark ist und dann zerbrechlich in einem Brunnen liegt, dieses Bild ließ mich nicht los." Das schreibt Valery Tscheplanowa, eine der anziehendsten Theaterschauspielerinnen der Gegenwart. Eine sinneskluge Darstellerin, deren Spiel auf geheimnisvolle Weise unbeeinflusst wirkt von den Abläufen und Forderungen unserer Zeit. Gerade hat man sie noch bei den Salzburger Festspielen gesehen, als wortgenauen "Nathan" in einer Inszenierung von Ulrich Rasche (F.A.Z. vom 31. Juli). Gerade hat man noch mit ihrer Ankündigung gehadert, sich in Zukunft vornehmlich Film und Fernsehen zuzuwenden. Da kommt dieses Buch.
Es erzählt keine zusammenhängende Geschichte und liest sich doch als in einem Stück komponiert. Das Wichtigste in diesem Roman ist die Zeit. Um ihr auf den Zahn zu fühlen, ist er geschrieben. All die berührenden Bilder und behutsamen Worte, mit dem der Text aufwartet, dienen dem einen Ziel: etwas kenntlich zu machen von dem, was sonst unbeobachtet vor sich hin läuft - der Sand in der Uhr, die sich gleich wieder wendet, um ein nächstes Leben zum Verschwinden zu bringen. Dagegen schreibt Tscheplanowa an. Sie hat die Geschichten von vier Frauen in der sowjetischen Provinz miteinander verwoben. Schauplatz ist ein Kurort bei Kasan, in dem schon Stalin Urlaub machte. In ihn kehrt die Protagonistin Walja zurück, um etwas von ihren Prägungen zu verstehen. Ihrem Blick auf die Welt. Woher kommt ihr Gefühl, "niemanden zu brauchen"? Was ist mit dem Holzhaus, in dem die Alte wohnt? Dem bestickten Kissenbezug? Der Stelle, wo der mit Haut umwachsene Knochen auf die Prothese trifft? Lauter Erinnerungssplitter, die zusammengesetzt werden wollen.
Tscheplanowa geht vorsichtig mit den biographischen Zeichen jener vier Frauen um, deren präzise Beziehung zu ihr sie offenlässt. Sie stellt ihr Verschwinden nicht aus, sondern bemüht sich behutsam, ihren verblassten Physiognomien durch poetische Anekdoten aufs Neue Konturen zu verleihen. Mit der Genauigkeit ihrer Beschreibung verleiht sie ihren Leben Würde und Anziehung. Immer wieder ist ihre Achtung vor der Duldsamkeit und Disziplin der Frauen spürbar. Ihre Bewunderung für ihr Durchhaltevermögen in schlechten Zeiten bei zehrender Arbeit. Etwa, wenn sie, die oft Geschminkte und Verkleidete, die Fingernägel einer alten Bäuerin beschreibt: "Die immer noch festen Nägel waren nie zum Lackieren gedacht. Sie haben gepult und durchtrennt, gekratzt und umgegraben."
Unaufdringlich schieben sich Daten der sozialistischen Verfallsgeschichte zwischen die kurzen Erzählabschnitte. Wie 1991 Gorbatschow abgesetzt wurde, wie die Menschen in langen Schlangen für Eier anstanden, wie ein Mann in seiner Siebzig-Quadratmeter-Wohnung trotzig von einer Welt ohne Unterschiede weiterträumt. Vereinzelt bricht sich Bitterkeit Bahn, Verzweiflung über einen Weltgeist, der die Anschauungen einfach so auswechselte, ohne auf die betrogenen Seelen seiner Gläubigen Rücksicht zu nehmen: "Wie eine schützende Decke ist der Kommunismus über ihren Köpfen weggerissen worden, und nun ist Selbständigkeit gefragt. Woher aber Selbständigkeit nehmen, wenn man ein Leben lang Gehorsam gelernt hat?" Das ist für Tscheplanowa keine rhetorische Frage.
Und doch hält die Autorin das Politische auf Distanz, bleibt es im Ungefähren wie hinter einem Gazevorhang. Wichtiger sind ihr die Menschen und ihre Höfe, das, was bestehen bleibt und die Zeitenwenden überdauert: "Es hat sich im Hof nichts getan, während der Sozialismus vorbeizog und ein Kapitalismus für die oberen Zehntausend kam, und trotzdem bleiben die Stufen dieselben.. Ein starkes Vertrauen auf die Präsenz des Wunderbaren durchzieht Tscheplanowas Text. Zum Ausdruck kommt es nicht nur durch die abenteuerliche Reisebeschreibung einer Marien-Ikone, sondern etwa auch in der berührend dichten Beschreibung eines Sterbemoments. Nicht Trauer über den Tod, sondern Staunen über das auslaufende Leben kennzeichnet den Gestus des Schreibens in dieser Passage. Wie überhaupt stolze Erinnerung statt niedergedrückte Sentimentalität dieses besondere Buch bestimmt. Damit hebt es sich deutlich aus der inzwischen fast unüberschaubaren Menge an autobiographisch gefärbten Schauspielerbüchern hervor. Es geht Tscheplanowa nicht darum, ihr eigenes Leben zu erzählen. Gar vor einem deutschen Publikum Zeugnis abzulegen über ihre Herkunft und Heimat. Für Migrations-Voyeurismus ist sie nicht die Richtige. Sie braucht keine kritische Gegenüberstellung zweier Welten, um deutlich zu machen, dass sie sich eine Eigenheit bewahrt hat. Eine Kraft, die von weit her kommt und in ihr weiterlebt. Auf der Bühne, beim Rollenspiel, aber eben überraschenderweise auch in ihrem Schreiben. Nicht selten verwendet Tscheplanowa in ihrem Text die verführerisch romantische Formel des "als ob" - und drückt damit unauffällig ihre Sehnsucht nach einer anderen Zeit und Gefühlswelt aus.
Der Zufall und das zu frühe Ende - darum geht es diesem Buch neben seinen erzählerischen Absichten auch. Ein Kapitel unter der Überschrift "Die Papierheiligen" beginnt mit der Frage, wer der letzte Mensch sein wird, den wir vor unserem Tod sehen. Einer, den man sein Leben lang gekannt hat? Oder einer, der gerade zum ersten Mal ins Zimmer tritt? Es sind diese stillen, unaufdringlichen Grundszenarien menschlichen Fühlens, die "Das Pferd im Brunnen" zu einem außergewöhnlichen Leseerlebnis machen.
In der Schauspielerin Valery Tscheplanowa offenbart sich eine auf ihre Einfühlung stolze Erzählerin. Eine, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zeit "aus den Schubladen" zu befreien, in die sie gezwängt wurde, und von jenem Gefühl zu berichten, wenn "die Tage plötzlich andere Tage geworden sind". Das Vanitas-Motiv tritt hier nicht als bittere Klage auf, sondern als erstaunliche Tatsache. Ein lastloses Wundern durchzieht diesen Roman. Ein Wundern darüber, dass man nicht mehr Zeit miteinander gehabt hat. Nicht ein wenig mehr Zeit. SIMON STRAUSS
Valery Tscheplanowa: "Das Pferd im Brunnen". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2023. 192 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main