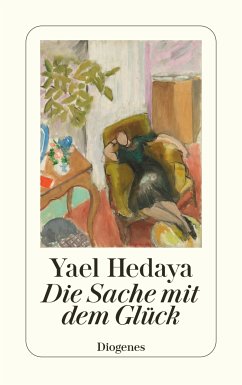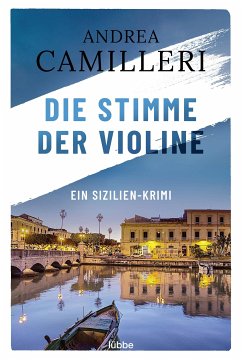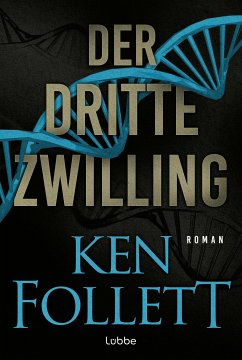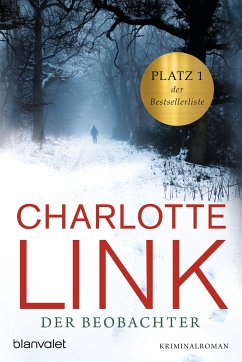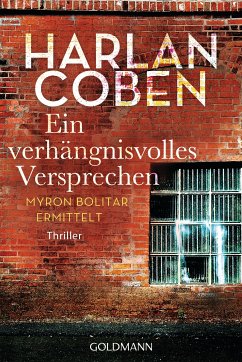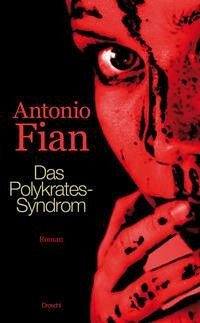
Das Polykrates-Syndrom (eBook, ePUB)
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
14,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Artur führt eine unspektakuläre, in geordneten Bahnen verlaufende Ehe mit der Mittelschullehrerin Rita, jobbt, obwohl Akademiker, in einem Kopierzentrum und als Nachhilfelehrer und ist ganz allgemein nicht sonderlich ehrgeizig oder anspruchsvoll. Bis eines Tages eine gewisse Alice den Copyshop betritt und eine Notiz hinterlässt ... Was nun ins Rollen kommt, ist eine Zeit lang ausgesprochen komisch, aber diese Komik nimmt unversehens immer düsterere, schließlich grauenhafte, wie einem Splattermovie entsprungene Formen an, und die bisher so satten und zufriedenen, vielleicht sogar glücklic...
Artur führt eine unspektakuläre, in geordneten Bahnen verlaufende Ehe mit der Mittelschullehrerin Rita, jobbt, obwohl Akademiker, in einem Kopierzentrum und als Nachhilfelehrer und ist ganz allgemein nicht sonderlich ehrgeizig oder anspruchsvoll. Bis eines Tages eine gewisse Alice den Copyshop betritt und eine Notiz hinterlässt ... Was nun ins Rollen kommt, ist eine Zeit lang ausgesprochen komisch, aber diese Komik nimmt unversehens immer düsterere, schließlich grauenhafte, wie einem Splattermovie entsprungene Formen an, und die bisher so satten und zufriedenen, vielleicht sogar glücklichen Romanfiguren sehen sich unausweichlich in Handlungen verstrickt, die weder sie sich selbst noch die Leser ihnen jemals zugetraut hätten. 'Es geht uns allen viel zu gut. Die Kinder sollen's einmal besser haben'. Der kurze Text 'Die guten Eltern' aus Antonio Fians Gedichtband Fertige Gedichte bringt das Polykrates-Syndrom auf den Punkt: Die Steigerung allzugroßen Glücks ist möglicherweise größtmögliches Unglück. Das sagt zumindest eine tief in uns verwurzelte Angst - und diese Angst und ihre Folgen stehen im Zentrum von Fians zweitem Roman.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.