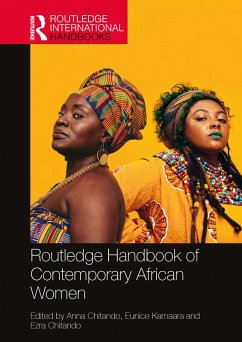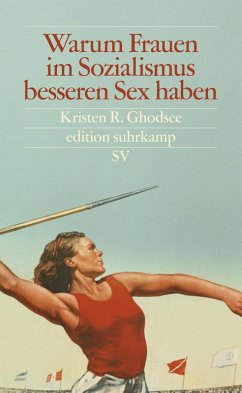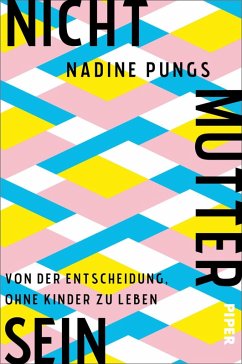Das Recht auf Sex (eBook, ePUB)
Feminismus im 21. Jahrhundert
Übersetzer: Arlinghaus, Claudia; Emmert, Anne
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was denken wir über Sex? Wie sollten wir darüber nachdenken? Angeblich ist Sex ganz privat, intim und doch wird er ständig mit öffentlicher Bedeutung aufgeladen und überfrachtet. Wir leben unsere ganz persönlichen Vorliebe beim Sex aus und doch wissen wir, dass er von äußeren, gesellschaftlichen Kräften geformt wird, denen wir nie entkommen. Vergnügen und Ethik klaffen beim Sex denkbar weit auseinander. Sex ist das Privateste und das Intimste. Gleichzeitig ist Sex öffentlich aufgeladen und ein Zustand des menschlichen Lebens, an dem Lust und Ethik weit und extrem auseinanderklaffen....
Was denken wir über Sex? Wie sollten wir darüber nachdenken? Angeblich ist Sex ganz privat, intim und doch wird er ständig mit öffentlicher Bedeutung aufgeladen und überfrachtet. Wir leben unsere ganz persönlichen Vorliebe beim Sex aus und doch wissen wir, dass er von äußeren, gesellschaftlichen Kräften geformt wird, denen wir nie entkommen. Vergnügen und Ethik klaffen beim Sex denkbar weit auseinander. Sex ist das Privateste und das Intimste. Gleichzeitig ist Sex öffentlich aufgeladen und ein Zustand des menschlichen Lebens, an dem Lust und Ethik weit und extrem auseinanderklaffen. Amia Srinivasans atemberaubendes Debüt spürt der Bedeutung von Sex in unserer Welt in den Zeiten von #MeToo nach. Erfüllt von der Hoffnung auf eine andere Welt, greift sie auf den politischen Feminismus für ihren Entwurf für das 21. Jahrhundert zurück. Was denken wir über Sex? Ist das Intime politisch? Srinivasen diskutiert spannungsgeladene Beziehungen zwischen Diskriminierung, Vorlieben, Pornografie, Freiheit, Rassenungerechtigkeit, Lust und Macht. Dieser fulminante Wurf ist Provokation und Versprechen zugleich und verändert viele unserer drängenden politischen Debatten. Srinivasan sucht nach Antworten auf eine Kernfrage unserer Zeit, dem veränderten Verhältnis der Geschlechter: Was bedeutet es, in der Öffentlichkeit wie im Privaten wirklich frei zu sein?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.