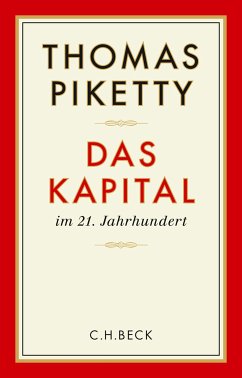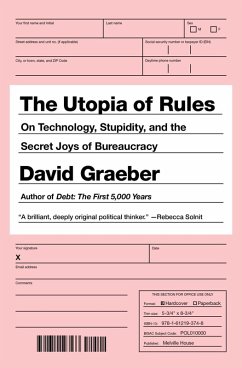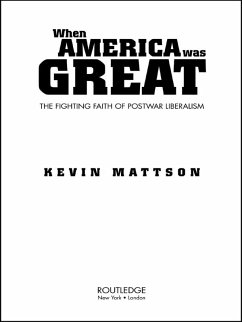Das Reich des kleineren Übels (eBook, ePUB)
Über die liberale Gesellschaft
Übersetzer: Denis, Nicola
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Mit seinem Essay "über die liberale Gesellschaft" avancierte Jean-Claude Michéa in kurzer Zeit zu einem der meistdiskutierten politischen Philosophen Frankreichs. In seiner ebenso scharfsinnigen wie spitzzüngigen theoriegeschichtlichen Untersuchung des Liberalismus zeigt Michéa, dass sich der kulturelle Liberalismus freier individueller Entfaltung, der heute zum Grundinventar linker Positionen gehört, nicht vom Wirtschaftliberalismus des freien Marktes trennen lässt und immer auf ihn zurückfällt. Gegen die linke Illusion, beide Spielarten des Liberalismus gegeneinander ausspielen zu k�...
Mit seinem Essay "über die liberale Gesellschaft" avancierte Jean-Claude Michéa in kurzer Zeit zu einem der meistdiskutierten politischen Philosophen Frankreichs. In seiner ebenso scharfsinnigen wie spitzzüngigen theoriegeschichtlichen Untersuchung des Liberalismus zeigt Michéa, dass sich der kulturelle Liberalismus freier individueller Entfaltung, der heute zum Grundinventar linker Positionen gehört, nicht vom Wirtschaftliberalismus des freien Marktes trennen lässt und immer auf ihn zurückfällt. Gegen die linke Illusion, beide Spielarten des Liberalismus gegeneinander ausspielen zu können, plädiert Michéa für eine Befreiung des Moralischen aus der Sphäre des Privaten und für allgemein verbindliche positive Werte. Nur so gelingt der Auszug aus dem "Reich des kleineren Übels" des Liberalismus. Eine radikale Intervention, die das politische Selbstverständnis von Links und Rechts grundlegend in Frage stellt und herausfordert.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.