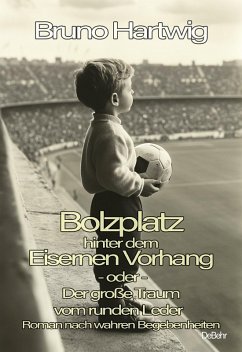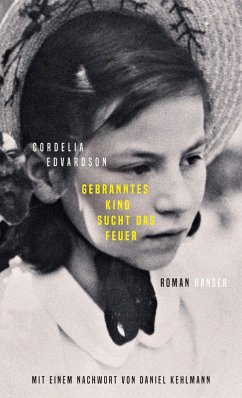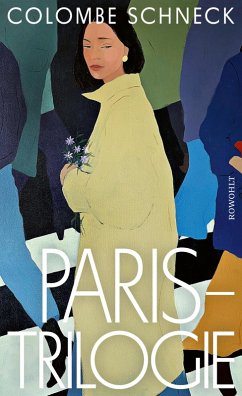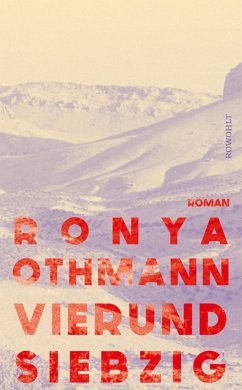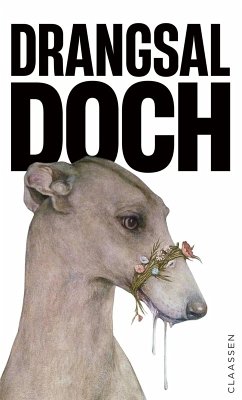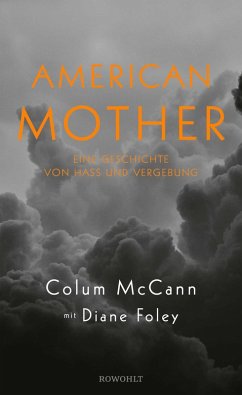Das Schachbrett (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie schon in seinem ersten Roman, Das Badezimmer, wo der Held das Badezimmer nicht mehr verlässt, spielen im Werk des großartigen Schriftstellers Jean-Philippe Toussaint geschlossene Orte eine große Rolle. Orte, an denen man ungestört über die Welt und deren gebrechliches Gefüge nachdenken kann. Als im Frühjahr 2020 von einem Tag auf den anderen sämtliche Pläne Toussaints über den Haufen geworfen werden, beginnt er, Stefan Zweigs Schachnovelle zu übersetzen, seine erste Übersetzung. Und so beschreibt er auf humorvolle Weise die Fallstricke dieser Übersetzung. Tag für Tag überset...
Wie schon in seinem ersten Roman, Das Badezimmer, wo der Held das Badezimmer nicht mehr verlässt, spielen im Werk des großartigen Schriftstellers Jean-Philippe Toussaint geschlossene Orte eine große Rolle. Orte, an denen man ungestört über die Welt und deren gebrechliches Gefüge nachdenken kann. Als im Frühjahr 2020 von einem Tag auf den anderen sämtliche Pläne Toussaints über den Haufen geworfen werden, beginnt er, Stefan Zweigs Schachnovelle zu übersetzen, seine erste Übersetzung. Und so beschreibt er auf humorvolle Weise die Fallstricke dieser Übersetzung. Tag für Tag übersetzend entsteht dabei, fast ungewollt, ein Buch. Und was der Autor in dem Moment noch nicht ahnt: Das Buch, das er im Begriff ist zu schreiben, nimmt unter seiner Hand einen autobiographischen Charakter an. Zum ersten Mal spricht Toussaint von sich in der ersten Person: Eine spannende Autofiktion entsteht. Wir treten mit Toussaint in sein Schreibzimmer, blicken ihm über die Schulter, wenn er schreibend zurück in seine früheste Kindheit geht, vom Leben - und vom Tod - erzählt. Wir erfahren, wie sich seine Berufung zum Schriftsteller offenbarte. Eine Reise in 64 Kapiteln beginnt, die den 64 Feldern eines Schachbretts entsprechen. Denn um das Schachspiel dreht sich alles in diesem Buch, Schach ist Dreh- und Angelpunkt seiner ausschweifenden Erinnerungen. Entstanden ist ein »wunderbares und extrem intelligentes Buch mit einer sehr hohen Auffassung von dem, was Literatur sein muss« (Transfuge). »Intelligent und weit davon entfernt, langweilig zu sein.« (Culture de France) Und Frédéric Beigbeder äußerte begeistert: »Ich musste oft an Modiano denken, als ich es las.«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.