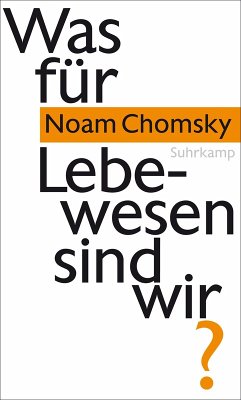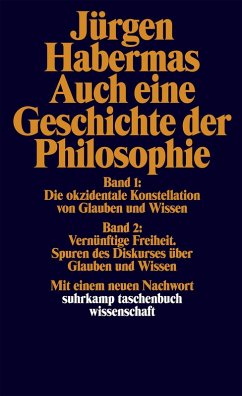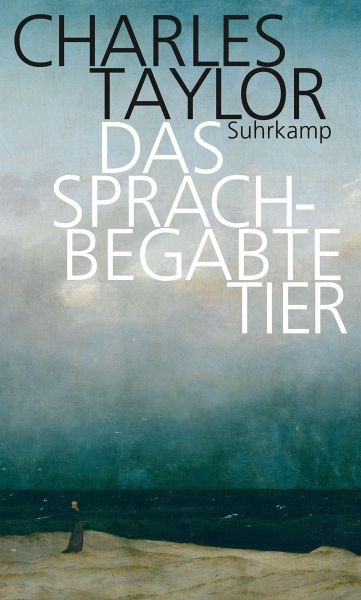
Das sprachbegabte Tier (eBook, ePUB)
Grundzüge des menschlichen Sprachvermögens
Übersetzer: Schulte, Joachim
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 44,00 €**
37,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Seit Jahrhunderten wird in der Philosophie über die Natur der Sprache gestritten. Für die rationalistisch-empiristische Tradition in der Folge von Hobbes, Locke und Condillac ist sie ein Werkzeug, das Menschen erfunden haben, um Informationen auszutauschen. In seinem neuen Buch bekennt sich Charles Taylor zum gegnerischen Lager der Romantik um Hamann, Herder und Humboldt und zeigt, dass der rationalistisch-empiristische Ansatz etwas Entscheidendes übersieht: Sprache beschreibt nicht bloß, sie erschafft Bedeutung, formt alle menschliche Erfahrung und ist integraler Bestandteil unseres indiv...
Seit Jahrhunderten wird in der Philosophie über die Natur der Sprache gestritten. Für die rationalistisch-empiristische Tradition in der Folge von Hobbes, Locke und Condillac ist sie ein Werkzeug, das Menschen erfunden haben, um Informationen auszutauschen. In seinem neuen Buch bekennt sich Charles Taylor zum gegnerischen Lager der Romantik um Hamann, Herder und Humboldt und zeigt, dass der rationalistisch-empiristische Ansatz etwas Entscheidendes übersieht: Sprache beschreibt nicht bloß, sie erschafft Bedeutung, formt alle menschliche Erfahrung und ist integraler Bestandteil unseres individuellen Selbst.
Taylor geht jedoch noch einen Schritt über das Denken der deutschen Romantik hinaus und entwirft eine umfassende Theorie der Sprache im Sinne des linguistischen Holismus: Sprache ist ein geistiges Phänomen, aber sie kommt auch in künstlerischen Darstellungen, Gesten, Stimmen, Haltungen zum Ausdruck und kennt daher keinen Gegensatz von Körper und Geist. Indem er dieses grundlegende Vermögen des »sprachbegabten Tiers« erhellt, wirft Taylor ein neues Licht darauf, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Taylor geht jedoch noch einen Schritt über das Denken der deutschen Romantik hinaus und entwirft eine umfassende Theorie der Sprache im Sinne des linguistischen Holismus: Sprache ist ein geistiges Phänomen, aber sie kommt auch in künstlerischen Darstellungen, Gesten, Stimmen, Haltungen zum Ausdruck und kennt daher keinen Gegensatz von Körper und Geist. Indem er dieses grundlegende Vermögen des »sprachbegabten Tiers« erhellt, wirft Taylor ein neues Licht darauf, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.