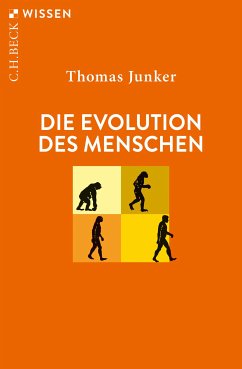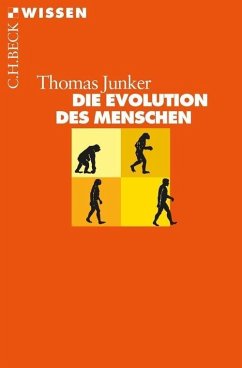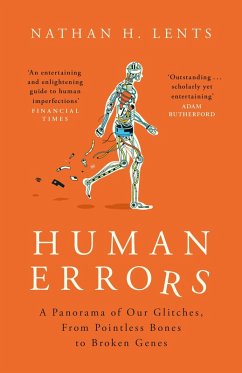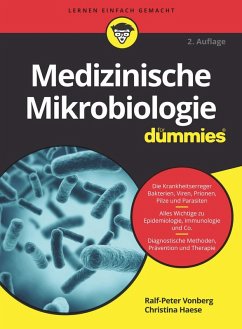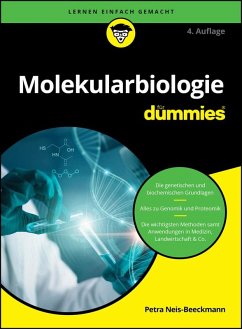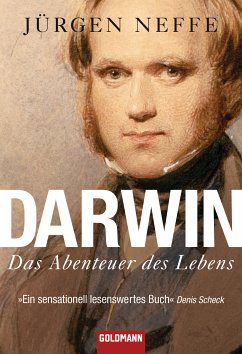Das Tier in uns (eBook, ePUB)
Die biologischen Wurzeln der Menschlichkeit
Sofort per Download lieferbar
Statt: 32,00 €**
25,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das menschliche Leben jenseits von Populismus, Ideologie und Rassismus verstehen Auch Menschen sind nur Tiere. Unsere Persönlichkeiten sind daher zutiefst mit unseren Körpern verbunden. Menschen neigen aber dazu, die Biologie des Körpers mit ideologischen Vorstellungen von Rasse, Sex und Vererbung zu überfrachten. Mitreißend zählt Martin Bleif all das auf, was wir wissen sollten, um über die Biologie des Menschen sachlich und ideologiefrei mitreden zu können. Mythen von Volk und Rasse, Sex und Gender, Vererbung oder Erziehung, die Versuche im »Dritten Reich«, Menschen zu züchten, od...
Das menschliche Leben jenseits von Populismus, Ideologie und Rassismus verstehen Auch Menschen sind nur Tiere. Unsere Persönlichkeiten sind daher zutiefst mit unseren Körpern verbunden. Menschen neigen aber dazu, die Biologie des Körpers mit ideologischen Vorstellungen von Rasse, Sex und Vererbung zu überfrachten. Mitreißend zählt Martin Bleif all das auf, was wir wissen sollten, um über die Biologie des Menschen sachlich und ideologiefrei mitreden zu können. Mythen von Volk und Rasse, Sex und Gender, Vererbung oder Erziehung, die Versuche im »Dritten Reich«, Menschen zu züchten, oder die Selbstoptimierungsphantasien in Leistungsgesellschaften belegen, dass wir Menschen das Verhältnis zu unserem Körper klären müssen. Martin Bleif schildert erhellend und mit ansteckender Entdeckerfreude das Wunder unserer körperlichen und neurologischen Grundausstattung. In seinem fulminanten Werk veranschaulicht er, ausgehend von der menschlichen Evolution, die Funktion und Bedeutung menschlicher Gene und Zellen bis hin zur neurologischen Architektur des Gehirns. Sachlich und ideologiefrei vermittelt er die neuesten Erkenntnisse darüber, was die Biologie über den menschlichen Körper tatsächlich weiß. Wieder geraten wir ins Staunen über unsere überwältigenden Fähigkeiten, die emotionalen wie intellektuellen, ohne den Menschen erneut eine Sonderstellung in der Ordnung der Natur - etwa als Krone der Schöpfung - anzumaßen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.