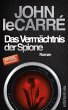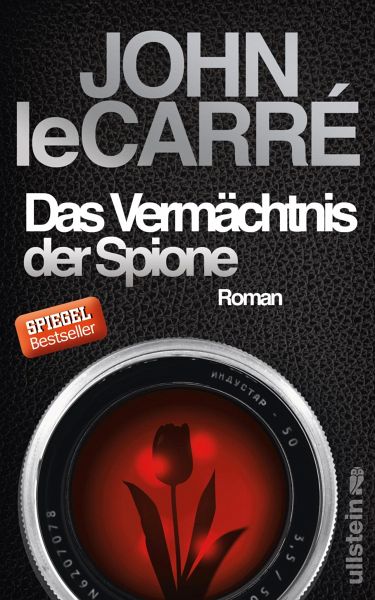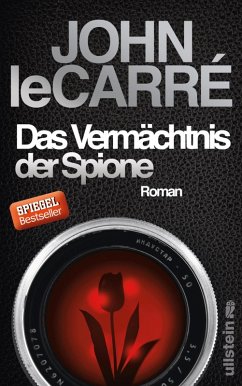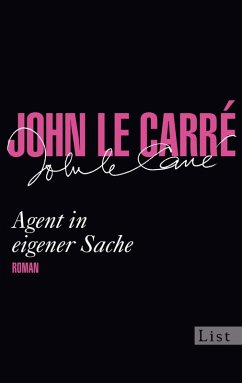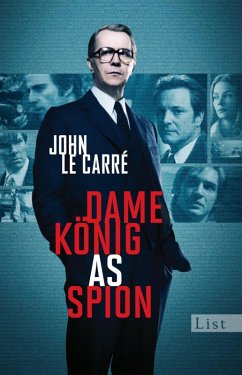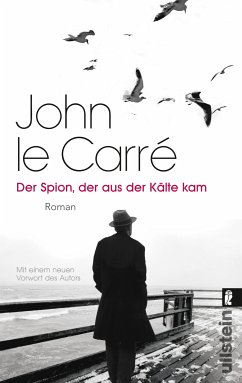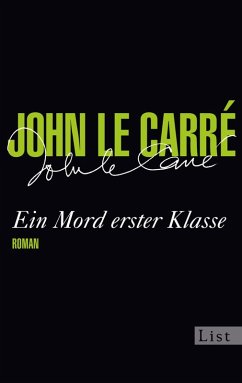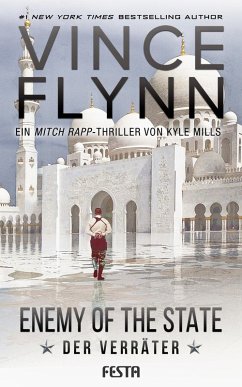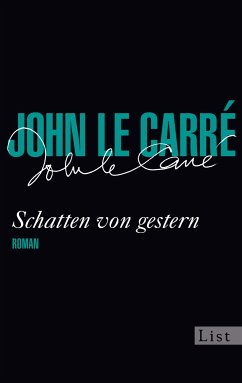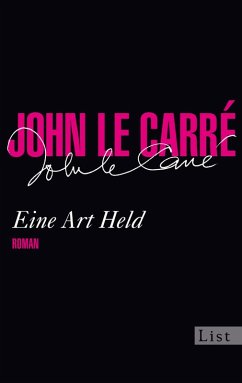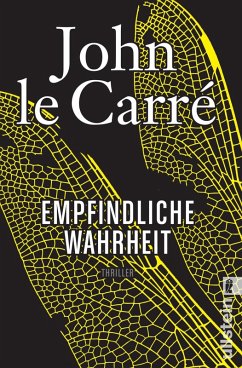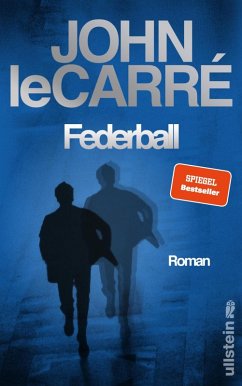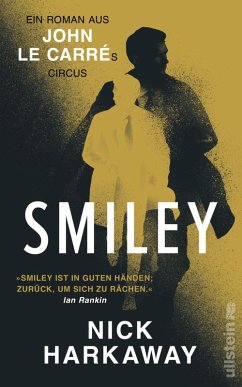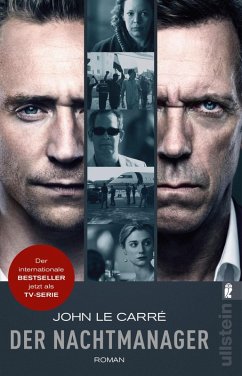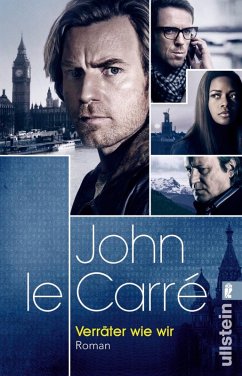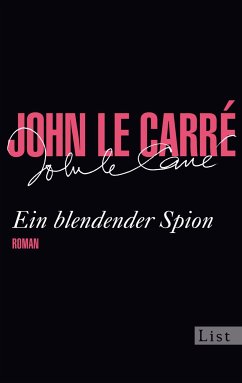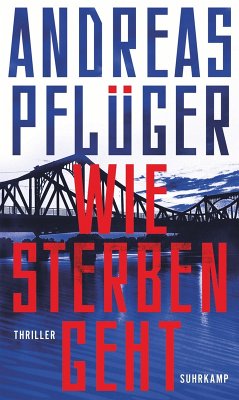John le Carré
eBook, ePUB
Das Vermächtnis der Spione / George Smiley Bd.9 (eBook, ePUB)
Roman
Übersetzer: Torberg, Peter
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 12,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Das geniale Finale der Welterfolge "Der Spion, der aus der Kälte kam" und "Dame, König, As, Spion" 1961: An der Berliner Mauer sterben zwei Menschen, Alec Leamas, britischer Top-Spion, und seine Freundin Liz Gold. 2017: George Smileys ehemaliger Assistent Peter Guillam wird ins Innenministerium einbestellt. Die Kinder der Spione Alec Leamas und Elizabeth Gold drohen, die Regierung zu verklagen. Die Untersuchung wirft neue Fragen auf: Warum mussten die Agenten an der Berliner Mauer sterben? Hat der britische Geheimdienst sie zu leichtfertig geopfert? Halten die Motive von damals heute noch st...
Das geniale Finale der Welterfolge "Der Spion, der aus der Kälte kam" und "Dame, König, As, Spion" 1961: An der Berliner Mauer sterben zwei Menschen, Alec Leamas, britischer Top-Spion, und seine Freundin Liz Gold. 2017: George Smileys ehemaliger Assistent Peter Guillam wird ins Innenministerium einbestellt. Die Kinder der Spione Alec Leamas und Elizabeth Gold drohen, die Regierung zu verklagen. Die Untersuchung wirft neue Fragen auf: Warum mussten die Agenten an der Berliner Mauer sterben? Hat der britische Geheimdienst sie zu leichtfertig geopfert? Halten die Motive von damals heute noch stand? In einem dichten und spannungsgeladenen Verhör rekonstruiert Peter Guillam, was kurz nach dem Mauerbau in Berlin passierte. Bis George Smiley die Szene betritt und das Geschehen in einem neuen Licht erscheint. Der Spion, der aus der Kälte kam ... ist zurück - Der ultimative Roman über die dunklen Seiten der Geheimdienste Große TV-Doku "Der Taubentunnel" an 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.69MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Entspricht WCAG Level AA Standards
- Entspricht WCAG 2.2 Standards
- Grundlegende Landmark-Navigation für einfache Orientierung
- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation
- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 4.5 =>1)
- Inhalte verständlich ohne Farbwahrnehmung
- Sprache des Textes für Text-to-Speech optimiert
- Kurze Alternativtexte für nicht-textuelle Inhalte vorhanden
- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis für direkten Zugriff auf Text und Medien
- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1
John le Carré, 1931 geboren, studierte in Bern und Oxford. Er unterrichtete in Eton, bevor er während des Kalten Krieges für den britischen Geheimdienst arbeitete. 2011 wurde er mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet. Seit nunmehr über fünfzig Jahren ist das Schreiben sein Beruf. Er lebt in London und Cornwall.

Produktdetails
- Verlag: Ullstein Taschenbuchvlg.
- Seitenzahl: 320
- Erscheinungstermin: 13. Oktober 2017
- Deutsch
- ISBN-13: 9783843717014
- Artikelnr.: 49017578
"Nicht nur deshalb lohnt es, das Spätwerk dieses Chronisten des Kalten Krieges zur Hand zu nehmen. Die Ideologien jener Jahre mögen sich überholt haben, die düsteren Wahrheiten, die John le Carré serviert, sind leider zeitlos." Sandra Kegel Frankfurter Allgemeine Zeitung 20171204
Die Vergangenheit holt einen immer ein
John le Carrés neuer Roman „Das Vermächtnis der Spione“ knüpft an die Handlung seiner Erfolge „Der Spion, der aus der Kälte kam“ und „Dame, König, As, Spion“ an. Im Mittelpunkt steht allerdings …
Mehr
Die Vergangenheit holt einen immer ein
John le Carrés neuer Roman „Das Vermächtnis der Spione“ knüpft an die Handlung seiner Erfolge „Der Spion, der aus der Kälte kam“ und „Dame, König, As, Spion“ an. Im Mittelpunkt steht allerdings nicht der berühmte britische Agent George Smiley, sondern sein ehemaliger Assistent Peter Guillam. Worum geht es?
Guillam, halb Engländer, halb Franzose, der seinen Ruhestand auf einem alten Bauernhof in der Bretagne genießt, wird nach London zitiert. Es geht um seine damalige Rolle in der Operation WINDFALL, die mitten im Kalten Krieg gegen die STASI geführt wurde und 1961 mit dem Tod des britischen Top-Spions Alec Leamas und seiner Freundin Liz Gold endete.
Die Kinder der Spione drohen nun, die Regierung zu verklagen. Warum mussten die beiden Agenten an der Berliner Mauer sterben? Zitat: „Da George nicht verfügbar ist, haben sie mich [Guillam] in der Rolle des Bösewichts besetzt.“ Oder soll Guillam den Sündenbock geben? Guillam muss sich auch damit auseinandersetzen, wie er selbst eine Frau verriet, die er liebte.
Gekonnt verbindet John le Carré, in „Das Vermächtnis der Spione“ Vergangenheit und Gegenwart zu einem spannenden Plot über die dunklen Seiten der Geheimdienste. Erzählt wird die Geschichte in der Ich-Perspektive aus Sicht von Guillam. Ab und zu werden aber auch Briefe und Berichte aus jener Zeit eingestreut.
Das Verhör ist interessant und informativ, keine Frage. Aber das Lesen der Protokolle ist durch die vielen Decknamen und Abkürzungen anstrengend und ermüdend. Das geht ein bisschen zu Lasten der Spannung. Am Ende ist Guillam auf der Flucht: Zitat: „Wenn die Wahrheit dich einholt, sei kein Held, lauf weg.“ Doch Guillam entschließt sich stattdessen, Smiley aufzuspüren...
Immer mal wieder finden sich Bezüge zu den Vorgängern, erscheinen alte Bekannte. Über das Wiedersehen mit Smiley & Co. habe ich mich sehr gefreut. Denn „Der Spion, der aus der Kälte kam“ und „Dame, König, As, Spion“ gehören für mich zu den besten Spionageromanen, die ich je gelesen habe.
Fazit: Das große Finale der George Smiley-Serie, spannend und faszinierend zugleich.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Die Vorgängerbücher, auf die hier Bezug genommen wird, habe ich nicht gelesen. Ich finde auch nicht, daß dies unbedingt notwendig ist. John le Carré beschreibt die Vorgänge an der Berliner Mauer aus dem Jahre 1961, bei dem zwei Personen bei einem Fluchtversuch, erschossen …
Mehr
Die Vorgängerbücher, auf die hier Bezug genommen wird, habe ich nicht gelesen. Ich finde auch nicht, daß dies unbedingt notwendig ist. John le Carré beschreibt die Vorgänge an der Berliner Mauer aus dem Jahre 1961, bei dem zwei Personen bei einem Fluchtversuch, erschossen wurden, so eindringlich und deckt Hintergründe auf, er macht den Leser mit den damaligen Protagonisten des britischen Geheimdienstes bekannt, so daß man durch aufmerksames Lesen einen Eindruck der Zeit des Kalten Krieges erhält.
Den nun fast 80-jährigen ehemaligen Spion des britischen Geheimdienstes, Peter Guilliam holt die Vergangenheit ein. Es war damals sein Freund Alec Leamas und dessen Freundin Elizabeth Gold, die an der deutsch/deutschen Grenze erschossen wurden. Nun wollen deren Kinder eine Klage auf Schadenersatz einreichen.
Um die damaligen Verhältnisse aufzuklären, wird Peter Guilliam nach London beordert und soll dem Geheimdienst Rede und Antwort stehen. Es ist geradezu genial zu lesen, wie dem Leser die Gedankengänge des ehemaligen Spions nahegebracht werden, er aber wohlüberlegt nur das Allernötigste preisgibt oder gar nicht antwortet. Diese Befragungen sind ein Meisterstück des Autors. Ich habe eine große Sympathie für Peter Guilliam empfunden, der als ganz junger Mann dem Geheimdienst beigetreten ist, aber wohl eher immer auf Anordnung gehandelt hat. Und nun soll er hier Verantwortung übernehmen.
Mich hat das Buch sehr beeindruckt. Mit seinem Schreibstil beweist John le Carré sein großes schriftstellerisches Können. Alle, die die vorhergehenden Bände gelesen haben, werden dieses Buch nicht versäumen, aber auch für alle anderen Leser ist dieses Buch ein absolutes Highlight und absolut empfehlenswert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Spionagethriller der alten Schule
John Le Carre war und ist der Meister des Spionage-Romans. Das liegt zum einen daran, dass das Genre heute nicht mehr so verbreitet ist, zum anderen daran, dass zu Le Carre’s Stilmittel die moralische Instanz gehört, die er vertritt und die er seinen …
Mehr
Spionagethriller der alten Schule
John Le Carre war und ist der Meister des Spionage-Romans. Das liegt zum einen daran, dass das Genre heute nicht mehr so verbreitet ist, zum anderen daran, dass zu Le Carre’s Stilmittel die moralische Instanz gehört, die er vertritt und die er seinen Hauptfiguren, bei all deren Zweifeln manchmal, verleiht. Das ist heutzutage verpönt und da andere Große des Genres bereits verstorben sind, bleibt nur Le Carre.
Sein Geniestreich bei diesem Roman ist die Erzählweise als Mischung aus vergangenen und heutigen Ereignisse während eines Verhörs, dass Jahrzehnte zurückliegende Ereignisse zu Tage bringt. Dieses Stilmittel hat der Autor auch früher schon erfolgreich genutzt und es sagt mir sehr zu.
Ich habe zu dem Hörbuch gegriffen und profitiere noch zusätzlich von der Stimme von Walter Kreye. Er gibt der Hauptfigur zusätzlich Profil und verleiht ihm Persönlichkeit. Der Bericht des alten Mannes, der vor langer Zeit vom Geheimdienst angeworben wurde, ist erstaunlich emotional.
Zuerst erzählt er von seinen Eltern und seinen ersten Lebensjahren und von den Kriegsjahren bis er als junger Mann in die Bretagne zurückkehrte.
Danach geht es um den Vorfall mit 2 toten Spionen 1961 an der Berliner mauer, der Operation Windfall und den Verwicklungen dazu. Die Kinder der toten Agenten Alec und Liz wollen nah all der Zeit die Hintergründe geklärt haben.
Das Vermächtnis der Spione ist am Anfang überwiegend gute Unterhaltung, aber meiner Meinung nach wird es zu lang. Die Spannung hält nicht durchgängig, erst Recht wenn dem Leser(Hörer die Vorgeschichte nicht bekannt ist. Die Handlung wird detailliert, wer nicht zu den Kennern der George Smiley-Romane gehört, kann teilweise den Hintergründen nicht folgen. Aber am Schluß gibt es auch mit George Smiley ein Wiedersehen.
Es bleibt eine gute Erzählhaltung und Wortwitz. Ich gebe 4 Sterne!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
John le Carré Thriller kenne ich einige als Buch aber auch als Verfilmung. Seine Kunst hinter die Kulissen der Geheimdienste zu schauen, fand ich immer sehr spannend. Dies ist nun mein erstes Hörbuch von ihm. Ich kenne nicht alle Vorgängerbände dieser Reihe, aber das sollte …
Mehr
John le Carré Thriller kenne ich einige als Buch aber auch als Verfilmung. Seine Kunst hinter die Kulissen der Geheimdienste zu schauen, fand ich immer sehr spannend. Dies ist nun mein erstes Hörbuch von ihm. Ich kenne nicht alle Vorgängerbände dieser Reihe, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, dachte ich. Aber ich kam nur sehr schwer rein.
Peter Guillam, Spion im Ruhestand wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Es gibt auf einmal Fragen zu dem Fall Windfall, wo in den 60er Jahren zwei Menschen an der Berliner Mauer starben. Peter muss zurück nach London und sich vielen Fragen stellen. Dabei wird versucht ein Geflecht von Spionen, Doppelagenten im Kalten Krieg zu lösen. Jedenfalls versuchte ich das als Hörerin. Denn man wird mit einer Vielzahl von Informationen überschüttet, wo man erst einmal nicht weiß, ist das wichtig oder kann das weg. Dazu zählen viele private Infos von Peter, die ich versuchte zu merken und mit dem eigentlichen Fall in Zusammenhang zu bringen. Dazu kommt noch eine Vielzahl von Personen, die ich kaum auseinander halten konnte. Gerade bei einem Hörbuch fällt es mir schwer.
Es zog sich insgesamt sehr in die Länge und ich musste mich doch öfters zwingen weiter zu hören. Durch das Abschweifen von der eigentlichen Haupthandlung zu den vielen Nebenschauplätzen baute sich kaum eine Spannung auf. Es plätscherte so vor sich hin. Ich muss wirklich sagen, das kann le Carré besser. Der Sprecher Walter Kreye dagegen macht einen guten Job. Unaufgeregt ohne übertriebene Betonung führt er durch den Roman.
Also ich kann den Roman als Hörbuch nicht empfehlen, dafür ist er zu unübersichtlich. Auch fehlt mir ein Spannungsbogen, so wie ich ihn aus anderen le Carré Thrillern kenne. Die Hintergründe zu den Agenten im Kalten Krieg bieten guten Stoff und der Plot ist durchaus gelungen, aber leider verliert sich le Carré in zu vielen Nebeninformationen, schade.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Die Spionage-Welt um Mastermind Smiley geht weiter. Ein alternder Ex-Spion, der seinen Ruhestand mehr oder minder genießt, wird eines Tages vom Geheimdienst in die Mangel genommen. Ein alter Fall wird wieder aufgerollt, weil Privatpersonen gegen die Regierung vorgehen und den Tod ihrer Eltern …
Mehr
Die Spionage-Welt um Mastermind Smiley geht weiter. Ein alternder Ex-Spion, der seinen Ruhestand mehr oder minder genießt, wird eines Tages vom Geheimdienst in die Mangel genommen. Ein alter Fall wird wieder aufgerollt, weil Privatpersonen gegen die Regierung vorgehen und den Tod ihrer Eltern gerächt haben wollen. Für Peter wird es nun eng. Natürlich erinnert er sich an den fatalen Auftrag und die Toten. Doch was damals im Zuge der DDR-Spionage wirklich passierte und wer die Verantwortung tragen soll, ist ungeklärt. Die Welt des Spions wird auf den Kopf gestellt. Seine Versuche, sich unwissend zu stellen oder die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken, misslingen. Letztendlich muss er seine Beteiligung einräumen und führt die Beamten zu den gut versteckten Akten, die die Wahrheit ans Licht bringen sollen. Doch der Mann, der Peter entlasten könnte, Smiley, ist verschwunden.
Wie kein Zweiter schafft es LeCarre, die letzte romantische Verklärtheit über die Welt der Spione mit präziser Beobachtung und schonungsloser Brillanz vom Tisch zu fegen. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Selbst diejenigen, die einen Hauch von Menschlichkeit zeigen, sind zum Schluß doch nur Marionetten in einem perfiden Spiel der Mächte. Menschen, ob im Dienste der Regierung beschäftigt oder nur durch Zufall in die Windmühlen des Systems geraten, sind jeder Zeit entbehrlich. Gegenspionage, raffinerte und bösartige Pläne, schmutzige Spuren zu verwischen sind nur einige Beispiele dieser Schattenwelt, die im verborgenen ihre Netze spinnt. LeCarre entwirrt dieses Netz wieder aufs Beste, zeigt die Gefühlskälte der Geheimdienste und die Hoffnungslosigkeit der Versuche, aus dem System auszubrechen. Selbst doppelte Identitäten schützen die Protagonisten nicht. Und am Ende des Buches bleibt der bittere Nachgeschmack, dass für den Tod Verantwortliche doch ein Schlupfloch finden und weiterhin ihr Marionettenspiel aufführen. Ein durchweg gelungener Roman auf gewohnt hohem Niveau.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der Roman „Das Vermächtnis der Spione“ knüpft an die Bücher „Der Spion, der aus der Kälte kam“ und „Dame, König, As, Spion“ an, die ich vor sehr langer Zeit gelesen habe.
An der Berliner Mauer sterben 1961 zwei Menschen. Es handelt sich …
Mehr
Der Roman „Das Vermächtnis der Spione“ knüpft an die Bücher „Der Spion, der aus der Kälte kam“ und „Dame, König, As, Spion“ an, die ich vor sehr langer Zeit gelesen habe.
An der Berliner Mauer sterben 1961 zwei Menschen. Es handelt sich um den britischen Spion Alec Leamas und seine Freundin Liz Gold. Weil die Kinder der beiden die Regierung verklagen wollen, wird Peter Guilliam, der ehemals Assistent von George Smiley war, ins Innenministerium einbestellt. Man will klären, was damals geschah und warum die beiden sterben mussten. George Smiley ist nicht auffindbar und so hält man sich an Peter, denn die alten Akten geben nicht viel her. Auch die Rolle von Guilliam in der Operation „Windfall“ soll beleuchtet werden und macht versucht ihn zum Schuldigen zu machen.
Wir lernen die Geschichte aus der Sicht von Peter Guilliam kennen, der bei der Befragung Rede und Antwort stehen muss. Zwischendurch gibt es auch immer wieder einmal Dokumente aus jener Zeit.
Obwohl es durchaus interessant ist, diese Geschichte zu verfolgen, ist es aber auch nicht einfach am Ball zu bleiben. Es gibt sehr viele Personen, die auch noch unter Decknamen agiert haben. Man muss also stets konzentriert bleiben. Peter muss sich während der Befragung auch mit seiner eigenen Rolle auseinander setzen. Wer für den Geheimdienst arbeitet, darf nicht zimperlich sein und ein Privatleben bleibt oft auf der Strecke.
John le Carré weiß, wovon er schreibt, denn er war selbst einmal britischer Agent. Aber dieses Buch ist kein Action-Thriller und soll es auch nicht sein. Die handelnden Personen sind ziemlich sachlich beschrieben. Alle Zusammenhänge sind klar und schlüssig dargestellt, so dass die Handlungen nachvollziehbar sind.
Ich finde es fürchterlich, was sich zu Zeiten des Kalten Krieges auf Geheimdienstebene abgespielt hat. Meine Sympathien für die Agenten halten sich also in Grenzen, dennoch ist es sehr interessant, darüber zu lesen und Carrés unvergleichlicher Schreibstil sorgt dafür, dass man gefesselt wird.
Mir hat das Buch gut gefallen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Würdiges Finale
„Das Vermächtnis der Spione“ ist der 9. Band der George-Smiley-Reihe von John leCarrè. Dieses Mal steht allerdings der ehemalige Assistent von dem bekannten britischen Agent George Smiley im Mittelpunkt - Peter Guillam.
Das Buch ist in sich …
Mehr
Würdiges Finale
„Das Vermächtnis der Spione“ ist der 9. Band der George-Smiley-Reihe von John leCarrè. Dieses Mal steht allerdings der ehemalige Assistent von dem bekannten britischen Agent George Smiley im Mittelpunkt - Peter Guillam.
Das Buch ist in sich abgeschlossen und kann auch ohne Vorkenntnisse der anderen gelesen werden. Aber ich denke man findet sich wesentlich schneller in die Geschichte hinein, wenn diese bekannt sind, da es immer wieder Bezüge zu vorherigen Handlungen gibt und bekannte Charaktere auftauchen.
1961 kamen zwei Agenten an der Berliner Mauer ums Leben. Über 50 Jahre später wollen die Kinder der Toten die Regierung verklagen, da sie der Meinung sind, das der britische Geheimdienst zu leichtfertig mit dem Leben ihrer Eltern umgegangen ist.
Peter Guillam lebt auf einem Bauernhof in der Bretagne und ist längst im Ruhestand. Dort erhält er - George Smiley nicht auffindbar ist - nun eine Vorladung nach London und soll sich zu der damaligen Operation Windfall äußern. Wird es nach so langer Zeit möglich sein, die wahren Hintergründe dessen, was geschehen ist, aufzudecken ?
Der Roman ist aus der Ich-Perspektive von Peter Guillam geschrieben und diese wird durch Briefe, Akten und Berichte aus der Vergangenheit ergänzt.
Wie auch in seinen vorherigen Büchern beschreibt der Autor komplexe Zusammenhänge authentisch und realitätsnah. Die Hintergründe der Geschichte werden schlüssig erklärt und die Charaktere werden sachlich und klar beschrieben. Ihre Handlungen sind nachvollziehbar.
Mich hat das Buch gefesselt und es ist für mich ein gelungenes Finale der der George-Smiley-Reihe von John leCarrè.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Einblick in die Spionage des Kalten Kriegs
Einige werden sich vielleicht noch erinnern, wie der britische Spion Alec Leamas und seine Freundin Liz Gold in "Der Spion, der aus der Kälte kam" 1961 an der deutsch-deutschen Grenze erschossen wurden. Doch auch, wer den Roman nicht kennt, …
Mehr
Einblick in die Spionage des Kalten Kriegs
Einige werden sich vielleicht noch erinnern, wie der britische Spion Alec Leamas und seine Freundin Liz Gold in "Der Spion, der aus der Kälte kam" 1961 an der deutsch-deutschen Grenze erschossen wurden. Doch auch, wer den Roman nicht kennt, wird an diesem Roman gefallen finden. Denn nun sind es die Kinder der Ermordeten, welche dem britischen Geheimdienst unterstellen, dieser hätte ihre Eltern damals geopfert.
Zur Beleuchtung der damaligen Vorkommnisse und Klärung der Verantwortlichkeiten wird George Smileys damaliger Assistent Peter Guillam nach London beordert. Smiley, der damalige Leiter der Abteilung Covert und zuständig für die Operationen MAYFLOWER und WINDFALL, sei nicht auffindbar - angeblich. Doch Guillam war ein guter Schüler Smileys. Wie befragt man einen Topagenten, der gelernt hat, nur zu sagen, was er auch preisgeben will? Und wer sagt, dass die Dokumente, welche nach über 50 Jahren auftauchen, wirklich die Wahrheit enthalten? So sehr George Smiley ein Meister der Taktik war, so sehr ist es auch diesmal John le Carré, der dem Leser nicht nur Einblicke in die damaligen Spionage-Operationen liefert, sondern ebenso in die Gedankengänge des gealterten, aber noch längst nicht alten Ex-Agenten Peter Guillam.
Der Roman berichtet rückblickend über die Operation MAYFLOWER, in welcher die Agentin TULIP (man beachte das Cover des Romans) eine tragische Rolle spielte und aus der sich schließlich die Operation WINDFALL entwickelte. Teilweise über echte oder täuschend echt gefälschte Dokumente, teils über Peter Guillams eigene Erinnerungen. Ein Roman, der nicht vor Action strotzt, sondern das hochdurchdachte Verwirrspiel der Spionage des Kalten Krieges eingehender beleuchtet. In meinen Augen ein weiteres Meisterwerk eines grandiosen Schriftstellers!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Viele Jahrzehnte hat Peter Guillam gehofft, dass er niemals wieder etwas hört. Doch dann kommt der unheilvolle Brief, der ihn von seinem bretonischen Bauernhof in die britische Hauptstadt und das Herz des Geheimdienstes beordert. Es sind Fragen aufgetaucht zur Operation Windfall. Anfang der …
Mehr
Viele Jahrzehnte hat Peter Guillam gehofft, dass er niemals wieder etwas hört. Doch dann kommt der unheilvolle Brief, der ihn von seinem bretonischen Bauernhof in die britische Hauptstadt und das Herz des Geheimdienstes beordert. Es sind Fragen aufgetaucht zur Operation Windfall. Anfang der 1960er Jahre kamen zwei Personen an der Berliner Mauer um, Alec Leamas, ein englischer Spion, und Elizabeth Gold, seine Freundin. Deren Kinder haben Zweifel an der Darstellung der Ereignisse. Peter soll aussagen, was damals geschah und Licht in das Verwirrspiel um Agenten, Doppelagenten und den Kalten Krieg bringen.
Als Fan von John Le Carrés Romanen habe ich mich sehr auf diesen neuen Krimi, in dem auch ein Wiedersehen mit George Smiley angekündigt war, gefreut. Allerdings bin ich am Ende doch reichlich enttäuscht, denn in keiner Weise kann „Das Vermächtnis der Spione“ in puncto Qualität und Spannung an die Vorgänger anknüpfen. Zu viele Längen lassen keinen richtigen Lesefluss aufkommen, letztlich irrelevante langatmige Beschreibungen lenken von den eigentlichen Fragen ab.
Die Grundkonstruktion ist durchaus clever gestaltet. Der Spion, der nach so vielen Jahrzehnten gedanklich zurückgeholt wird und für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Hier bin völlig bei dem Autor, das ist ein überzeugender Ansatz. Ob es jedoch dazu so ausführlich Peters familiären Hintergrund gebraucht hätte – eher nicht. Am ärgerlichsten war für mich jedoch der Aspekt der Werbung mit der Figur George Smiley – nein, das ist schlichtweg Irreführung des Lesers und Marketing mit bekannten Namen, das hat Le Carré nicht nötig.
So richtig hat mich das Drama um die beiden Toten nicht packen können, am ehesten noch die Nebenhandlung um die Agentin Tulip, die wenigstens etwas Persönlichkeit erhalten hat. Alles in allem zu oberflächlich, ohne jede Spannung und damit als Krimi für mich nicht überzeugend.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Peter (Pierre) Guilliam lebt seit einiger Zeit zurückgezogen auf seinem Bauernhof in der Bretagne bis ihn seine Vergangenheit einholt. Er war der Assistent von George Smiley und arbeitete für den britischen Geheimdienst. Er wird nach London "beordert" um zur Aufklärung eines …
Mehr
Peter (Pierre) Guilliam lebt seit einiger Zeit zurückgezogen auf seinem Bauernhof in der Bretagne bis ihn seine Vergangenheit einholt. Er war der Assistent von George Smiley und arbeitete für den britischen Geheimdienst. Er wird nach London "beordert" um zur Aufklärung eines Falles aus dem Jahr 1961 beizutragen, der Operation "Windfall". Aus den alten Akten kann man nichts brauchbares entnehmen, die jetzt aktiven Agenten versuchen mit allen Mitteln zu erfahren, was damals wirklich geschah. Zwei Menschen, der britische Agent Alec Leamas und seine Freundin, Elizabeth Gold, starben an der innerdeutschen Mauer. Jetzt klagen die Kinder von Alec und Liz auf völlige Aufklärung und Geld. Peter versucht sich zu erinnern, doch nicht alles was er weiß möchte er mitteilen. Wie viel Schuld trägt er selbst?
Der Roman verbindet die Gedanken der Vergangenheit mit den Aktionen der Gegenwart und auch Erinnerung an die Zeit nach 1961, an Liebe und Verrat. Die Stimme von Walter Kreye ist auf dem Hörbuch meistens in einer leiernden, teils gelangweilten, teils schnippischen Stimmlage zu hören. Leider werden alle Personen gleichermaßen gelesen, so dass es schwer fällt, den verschiedenen Zeitebenen und Personen zu folgen. Einiges in Berichtform zu verfassen ist an sich eine schöne Idee, die vielen Namen und Decknamen für die gleichen Personen tragen zur Verwirrung bei und beeinträchtigen das Hörvergnügen erheblich.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote