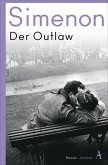Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Leipzigs Buchmesse bringt reiche litauische Literaturernte: Antanas Skemas moderner Klassiker "Das weiße Leintuch" liegt endlich auf Deutsch vor.
Das fängt ja gut an. "Gesegnet sind die Idioten, denn sie sind die glücklichsten Menschen auf Erden" lautet das erste von drei Mottos, die Antanas Skema seinem Roman "Das weiße Leintuch" voranstellt. Worauf müssen wir uns einstellen? Auf ein happy ending wie in einer Seligpreisung oder auf Epilepsie wie bei Dostojewski? So viel sei jetzt schon verraten: Der Mann, der da einige Jahre nach 1945 in New York seinem Arbeitsplatz in der 34th Street entgegenstrebt - an einem Nachmittag wohlgemerkt, kein normaler Bürojob -, dieser etwa vierzig Jahre alte Europäer hat Tabletten in der Tasche. Und in seinem Bewusstseinsstrom murmelt er gleich zu Beginn: "Viele Genies waren krank." Cäsar, Napoleon, Michelangelo - und eben auch Antanas Garsva, der Held dieses Buches.
Antanas Garsva, nicht nur durch den Vornamen als Alter Ego des Autors zu erkennen, ist in einem Hotel in einem Wolkenkratzer elevator operator, kurz gesagt: Liftboy. Toll, mit was für Menschen man in diesem Job in Berührung kommt: mit ehemaligen Boxern, (exil)russischen Geistlichen, Chiang-Kai-shek-Offizieren und Chinchilla-Züchtern. Ausschnitte aus dem richtigen Leben. Und wie im richtigen Leben geht es mal aufwärts, mal abwärts. Ganz ohne körperliche Mühe: "Sisyphos, von neuen Göttern an diesen Ort versetzt. Diese Götter sind humaner." Immer wieder Dialoge mit Hotelgästen und Partybesuchern: lebensnahe Skizzen oberflächlicher Begegnungen, die dennoch im Gedächtnis haftenbleiben.
Eine andere Lebenswelt in New York sind eine Kneipe, eine Wohnung, die Straßen. In der Kneipe sitzt Garsva an der Theke und sieht sich im Spiegel: "Blond und bleich, dunkle Augenringe, blaue Lippen. Die gespiegelte Maske verlangte geradezu danach, abgenommen und zerknüllt zu werden." Dabei hat er den Scotch noch gar nicht angerührt, den ihm der Kneipenbesitzer Stephens (in seinem früheren Leben Steponavicius) einschenkt und der sich durch den ganzen Roman hindurchzieht. Antanas Garsva sitzt hier, um über Elena und ihren Mann zu sprechen. Eine Dreiecksgeschichte. Antanas, der Dichter, und Elena, einst Gymnasiallehrerin, sind einander zugetan. Liebesszenen werden diskret geschildert. Doch ebenso häufig sprechen Elena und Antanas über dessen Lyrik.
Am Ende spürt Garsva: Er wird auch über den Abschied von Elena hinwegkommen, wie vorher in Litauen über den Verlust von Jone und Schenja. "Ich bin am Leben und frei. Ein absurder Mensch nach Camus? Mag sein. Ein absurder Mensch, der sich mit Christus unterhält. Und mit den Philosophen." Und er wird schreiben. "Sei gegrüßt, Spinoza! Es geht das Gerücht, du hättest dich auf die Philosophie gestürzt, weil du ein Mädchen verloren hast."
Schließlich ist da noch eine dritte Ebene: Immer wieder werden "Aufzeichnungen von Antanas Garsva" eingestreut. Kindheit und frühe Jahre in der Heimat. Bis in den Zweiten Weltkrieg reichen diese Kapitel. Der Erzähler spricht hier in der Ich-Form, während das Leben in New York überwiegend in der dritten Person beschrieben wird. Garsva lebt in der "winzigen Großstadt" Kaunas, der Hauptstadt des Landes in der Vorkriegszeit. Litauen lebt vor uns auf, ein katholisches Land an der Ostsee. Sumpfige Landschaft, Birken, der traurige Schrei der Kiebitze. Überall Wegkreuze und Heiligenfiguren, aber auch Teufel und alte baltische Götter.
Aufgrund des Hitler-Stalin-Pakts wird das Land der Sowjetunion einverleibt. Als 1941 die Wehrmacht marschiert, fliehen die Sowjets. Ein blutjunger Rotarmist verwickelt Garsva in einen Ringkampf auf Leben und Tod. Der Dichter greift nach einem spitzen Stein und zertrümmert dem Russen den Schädel. Wenige Jahre später sitzt er im Fahrstuhl und erinnert sich: "Der Steinzeitmensch ist noch am Leben in meinem Blut, in meiner Vergeltung." Erst später erfahren wir, worauf sich das bezieht: 1940, unter sowjetischer Besatzung, hatte ein NKWD-Mann Garsva brutal verhört, gedemütigt, ihm mit einem Briefbeschwerer eine Kopfverletzung beigefügt.
Jetzt sitzen sie also alle, vor der Roten Armee geflohen, in Amerika: Antanas Garsva, Elena, auch Doktor Ignas, der jüdische Psychiater aus Kaunas, der den Dichter auch in New York untersucht. Neurasthenie lautet die Diagnose; heute würde man wohl von Depression sprechen. Emigrantenschicksale - Skema (1910 bis 1961) hat sie verarbeitet, er hat vieles von dem Geschilderten selbst erlebt. Auch die Zeit in einem DP-Lager für Litauer in Bayern nach 1945, die am Ende kurz aufscheint. Hier ist auch ein künstlerischer Konflikt angedeutet, zu dessen Teilnehmer Skema selbst werden sollte: Ist es die Pflicht der Flüchtlinge, am "Boden" - so der Name einer damaligen Dichtergruppe - festzuhalten, Heimat und Identität als Bedingung menschlichen Daseins zu pflegen? Oder sollte der Mensch nicht seine Unbehaustheit auf der Erde anerkennen und, im Sinne einer "Theologie des Exils", wie es damals hieß, ins Universale streben?
"Wir müssen uns um das Volk kümmern", bekommt Garsva von seinem heimatverbundenen Kontrahenten im Flüchtlingslager zu hören, und dann, eher abgrenzend und abfällig gemeint: "Schreib über dich selbst." Das hat der Autor dieses Buches auch getan, und zwar ebenso großartig wie erschütternd. Der Sog dieser Lektüre ist stark. Claudia Sinnig hat das Buch präzise übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Ein Glück für Litauen, einst an der Memel Deutschlands Nachbar, dass es zu seinem Auftritt als Schwerpunktland der Leipziger Buchmesse dieses 1958 erschienene, wichtige Werk endlich übersetzt vorlegen kann.
GERHARD GNAUCK
Antanas Skema: "Das weiße Leintuch".
Aus dem Litauischen von Claudia Sinnig. Guggolz Verlag, Berlin 2017. 255 S., geb., 21,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH