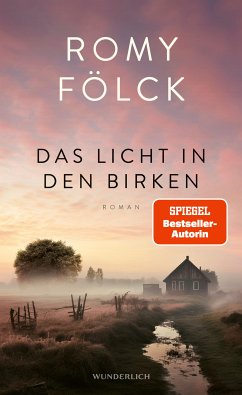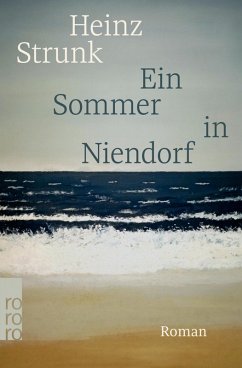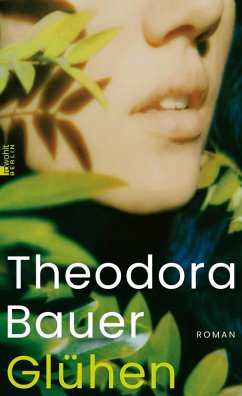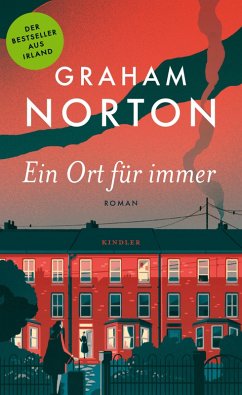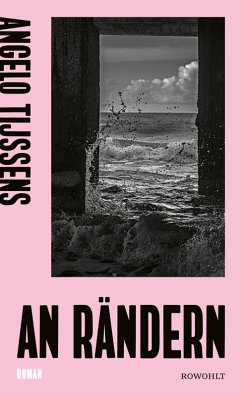Das Wiedersehen (eBook, ePUB)
Römische Geschichten «Lahiris Stimme ist außergewöhnlich!» Salman Rushdie
Übersetzer: Brandestini, Julika
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Von der Sehnsucht nach einer besseren Welt und vom Fremdsein in der schönsten aller Städte: Rom. Das neue Buch der vielfach ausgezeichneten Pulitzerpreisträgerin und «Meisterin der Kurzgeschichte» (Die Welt). Ein Mann erinnert sich an eine Sommerparty, die eine andere Version seiner selbst zum Leben erweckt hat. Ein Paar, das von einem tragischen Verlust heimgesucht wird, kehrt nach Rom zurück, um Trost zu suchen. Eine Außenseiterfamilie wird aus dem Wohnblock vertrieben, in dem sie sich niederzulassen gehofft hat. Eine Treppe in einem römischen Viertel verbindet das tägliche Leben de...
Von der Sehnsucht nach einer besseren Welt und vom Fremdsein in der schönsten aller Städte: Rom. Das neue Buch der vielfach ausgezeichneten Pulitzerpreisträgerin und «Meisterin der Kurzgeschichte» (Die Welt). Ein Mann erinnert sich an eine Sommerparty, die eine andere Version seiner selbst zum Leben erweckt hat. Ein Paar, das von einem tragischen Verlust heimgesucht wird, kehrt nach Rom zurück, um Trost zu suchen. Eine Außenseiterfamilie wird aus dem Wohnblock vertrieben, in dem sie sich niederzulassen gehofft hat. Eine Treppe in einem römischen Viertel verbindet das tägliche Leben der unzähligen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Dieses Buch ist ein eindrucksvolles Fresko von Rom, der verführerischsten Stadt von allen: widersprüchlich, in ständigem Wandel und ein Zuhause für diejenigen, die wissen, dass sie nicht ganz dazugehören können, sich aber trotzdem dafür entscheiden. «Das Wiedersehen» ist ein meisterhaftes Werk einer der großen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Jhumpa Lahiri hat es in ihrer geliebten Wahlsprache Italienisch verfasst und erzählt wie keine andere von Heimat und Zugehörigkeit. «Eine wunderschöne, elegante Prosa, Figuren, die von Leid, Isolation, Verlust, großen und kleinen Tragödien heimgesucht werden, und vor allem eine alles durchdringende, tiefe Menschlichkeit.» Khaled Hosseini
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.