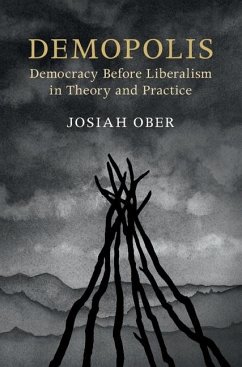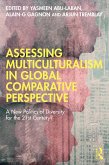Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Sollte sich die Bürgerschaft nicht besser selbst regieren? Josiah Ober zeigt, was es mit der Kerndemokratie auf sich hat
Der Untertitel der amerikanischen Originalausgabe ist präziser als der deutsche: "Democracy before Liberalism in Theory and Practice". Um aus der Sackgasse herauszukommen, in der die Demokratie offenkundig auch in nicht wenigen westlichen Ländern steckt, rät Josiah Ober, einen Schritt zurück zu machen und es mit einer "Kerndemokratie" zu versuchen, definiert als legitime Machtausübung eines Demos.
Wie beinahe alles Nachdenken über politische Ordnung seit Platon und Hobbes aus dem Menetekel von Spaltung und Bürgerkrieg erwuchs, hat auch Ober sein Buch "im Schatten der Furcht" geschrieben. Da die Demokratie üblicherweise untrennbar mit Wert- und Zielvorstellungen des Liberalismus verbunden werde, drohe Letzterer inzwischen, auch jene mit in den Abgrund zu reißen, seit er zunehmend und zutreffend mit Elitedenken, Technokratie, Globalisierung und Raubtierkapitalismus, aber auch mit der Vergottung von Vielfalt an sich und dem Verzicht auf traditionelle Werte gleichgesetzt werde und dramatisch an Legitimität verliere.
Obers Kerndemokratie ist eine gemeinschaftliche Selbstregierung der Bürger. Sie visiert drei elementare Ziele an: Sicherheit und Wohlstand auf einem angemessenen Niveau sowie eine nichtautokratische Regierung, wobei Autokratie als Gegenbild nicht unbedingt eine Monarchie oder Diktatur alten Typs sein muss, sondern auch eine Oligarchie, eine national-populistische Parteiherrschaft oder die von liberalen Theoretikern wie Jason Brennan propagierte Neuauflage der platonischen Philosophenherrscher in Gestalt von "Epistokraten des 21. Jahrhunderts" sein kann. Eine Kerndemokratie kümmert sich nicht in erster Linie um Fragen der persönlichen Autonomie, der unveräußerlichen Menschenrechte, der Verteilungsgerechtigkeit oder der religiösen Neutralität des Staates: Diese liberalen Kernanliegen werden nicht abgelehnt, aber im Sinne einer Entmischung als nachrangig beziehungsweise als Optionen sekundärer Aushandlungsprozesse betrachtet. Demokratie in ihrer grundlegenden Form sei "weder die Antithese noch die Umsetzung des Liberalismus".
Ober hat als Althistoriker von Graden die griechische Bürgerstaatlichkeit und zumal die Demokratie im antiken Athen als höchst erfolgreiche nicht-liberale Ordnungen vorgestellt (F.A.Z. vom 26. November 2016). Dies wird hier kurz resümiert und in einem monumentalischen Sinn aufgerufen: Weil eine solche Ordnung einmal möglich war, kann sie ermutigen, in eine ähnliche Richtung zu denken. Die antiken Besonderheiten, zumal die Kleinräumigkeit der politischen Einheiten und die heute unannehmbare Exklusion von Sklaven und Frauen, seien für das Modell an sich nicht konstitutiv, und zumindest die reformierte athenische Demokratie des vierten Jahrhunderts stellte tatsächlich keine Tyrannei der Mehrheit dar, sondern die an Regeln und Normen gebundene Selbstregierung durch eine gesellschaftlich breitgefächerte Bürgerschaft.
Der Autor greift ferner auf das wiederum antike Vorbild der Konstruktion einer gesellschaftlichen und politischen Ordnung per Gedankenexperiment zurück, um zu zeigen, wie in einem modernen, großen und hochdifferenzierten Staat "Demopolis" ein sicherer und erfolgreicher Verfassungsrahmen ohne Rückgriff auf die ethischen Annahmen der zeitgenössischen liberalen Theorie von Rawls oder Habermas, aber auch ohne die zentralen Annahmen des frühneuzeitlichen Liberalismus etabliert werden könne.
Nun mutet die Neukonstruktion eines Staatswesens gleichsam auf der grünen Wiese auf den ersten Blick einigermaßen abenteuerlich an, aber sie macht den Blick frei auf die Aporien bestehender Systeme und für Alternativen. Wer mit Ober etwa nach der Legitimierung einer Selbstregierung durch den Demos im Hinblick auf den dafür zu erbringenden individuellen Beitrag und Aufwand fragt oder nach Inhalten der Erziehung der Bürger zu einem kompetenten Demos, zielt damit zugleich auf ein mögliches Umsteuern in bestehenden Ordnungen. Und endlich zeigt mal jemand Wege auf, wie auch in hochkomplexen modernen Gesellschaften und Institutionen Bürger ihr eigenes Wissen, die Expertise von Fachleuten und die Routine von Repräsentanten in eine rationale Politik einspeisen können, ohne ihre faktische Entmündigung zu dulden!
Zeitgenössische Bücher zur Demokratie sind nicht selten theoretisch arkane, nach innen gewendete politikwissenschaftliche oder philosophische Traktate oder sie geraten zu meinungsstarken Pamphleten. Ober hingegen schreibt einen eingängigen Stil; er fasst immer wieder zusammen, wiederholt wichtige Argumente, entwirft einfache spieltheoretische Gedankenexperimente. Sein idealer Leser wäre auch ein guter Bürger von Demopolis: kein Spezialist, sondern ausgestattet mit Common Sense, nachdenklich, aber auch in die Lage versetzt, ohne Hang zum übermäßig Einfachen oder Extremen schwierige Materien rational in den Aggregatzustand entscheidungsfähiger Alternativen zuzuspitzen und "notfalls direkt zu regieren".
Der das Buch durchströmende Optimismus rührt erkennbar von einem Pathos des Entscheidens her, freilich nicht im existentiellen Modus schmittianischer Bipolarität, sondern geschult an der erzieherisch ungemein wirkungsvollen Praxis der athenischen Demokratie oder lokaler amerikanischer Graswurzelpolitik, sei es im achtzehnten Jahrhundert oder im heutigen Oregon.
Selbstverständlich kann man manche Prämissen kritisieren, etwa die naturalisierende und ursprungsmythische Ableitung demokratischen Handelns aus den menschlichen Grundfähigkeiten Geselligkeit, Vernunft und Kommunikation, wonach die gemeinsame Selbstregierung gar den "Standardmodus menschlicher Sozialorganisation für Tausende von Generationen vor dem Aufkommen der Landwirtschaft" dargestellt habe. Oder die mitunter penetrante sozialwissenschaftliche Regelkreisrhetorik. Dann gibt es wieder Passagen zum Verlieben, etwa wenn der Autor die eminente Bedeutung von Bürgerwürde für das Gelingen von Demopolis an der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung aufzeigt.
Aufmerksame Leser werden für sich entscheiden müssen, ob es bloßes Wunschdenken ist, nicht länger Größe und Komplexität der Regierung als eine Beschränkung von Demokratie zu betrachten, sondern "eher die Demokratie als eine Beschränkung der Größe und Komplexität der Regierung zu sehen". Ein bedeutendes, ja ein großes Buch ist "Demopolis" nicht zuletzt deshalb, weil Ober es versteht, historisch unterfütterte Plausibilität, pragmatische Vorschläge und wohltuende Radikalität im Denken und Fragen miteinander zu verbinden.
UWE WALTER
Josiah Ober: "Demopolis". Oder was ist Demokratie?
Aus dem Englischen
von Karin Schuler und
Andreas Thomsen.
Philipp von Zabern Verlag/
WBG, Darmstadt 2017.
320 S., Abb., geb., 39,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main