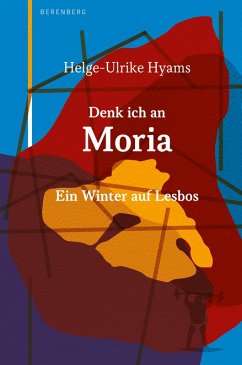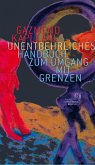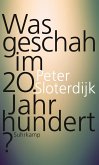Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Helge-Ulrike Hyams war Flüchtlingshelferin in dem Lager auf der griechischen Insel Lesbos und schildert hier den Winter 2019. Auch wenn das ein Jahr später durch ein Feuer zerstörte Camp aus den Schlagzeilen verschwunden ist, lohnt die Lektüre. Zu verdanken ist dies der stilistischen Eleganz der Autorin. Die emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften schildert angenehm unaufgeregt, dafür mit seismographischer Genauigkeit die seelische Verfasstheit ihrer syrischen und afghanischen Schützlinge. Ihr Hauptinteresse gilt den vielen jungen alleinstehenden Männern und Kindern, die sie als besonders traumatisiert erlebt. Deren Geschichten nachzuerzählen und sie damit dem Vergessen zu entreißen, hat sie sich zur Aufgabe gemacht. Eine verdienstvolle Arbeit, sind doch die geschilderten Schicksale von zeitloser Relevanz, wie aktuell Berichte kriegsvertriebener Ukrainer zeigen. Die von der Autorin vielfach beobachtete Resilienz der Geflüchteten in dem Elendslager Moria, ihre trotz widrigster Umstände nicht nachlassende Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sieht sie als Beweis für die Widerstandskraft der menschlichen Psyche unter außergewöhnlichen Belastungen. Diesen Schluss zog auch der jüdischstämmige Psychologe Viktor Frankl, dessen Haftberichte aus vier Konzentrationslagern die Autorin offenbar zu ihrem Bericht inspirierten. Übertrieben erscheint ihr Vergleich von Moria mit einem KZ der Nazizeit. Trost hingegen mag der Leser in der Erkenntnis finden, die Frankl und Hyams teilen: dass Menschen in schwierigsten Situation über sich selbst hinauswachsen. Nag.
"Denk ich an Moria - ein Winter auf
Lesbos" von Helge-Ulrike Hyams. Berenberg Verlag, Berlin 2022. 160 Seiten. Gebunden,
16 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main