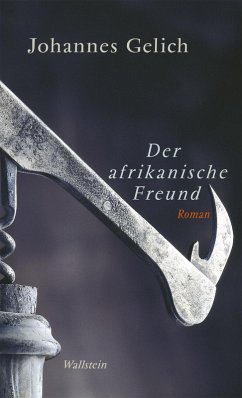Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Johannes Gelichs Roman "Der afrikanische Freund" als Vorabdruck in der F.A.Z.
"Heute Nacht ist Papa gestorben." Mit dieser Nachricht, deren Tragik zum Ich-Erzähler kaum durchzudringen scheint, beginnt der intelligente, vielschichtige und unerbittliche Roman "Der afrikanische Freund" des österreichischen Schriftstellers Johannes Gelich, den wir von heute an in dieser Zeitung vorabdrucken. Der initiale Tod des Vaters hat symbolische Obertöne: Das eherne Gesetz, die gewachsene Ordnung gerät ins Wanken. An Gott glaubt Papas verlorener Sohn schon gar nicht.
Im nüchtern-präzisen, Unheil prophezeienden Stil eines Geständnisses, der profanisierten Confessio, berichtet der Erzähler von den drastischen Ereignissen, die sich zugetragen haben, als er anlässlich der Beerdigungsangelegenheiten seine Geburtsstadt, Salzburg wohl, aufsuchte. Heimisch habe er sich hier nie gefühlt, teilt er mit. Von einem reichen Schulfreund, Max, wird er auf dessen Burg eingeladen, um mit zwei weiteren, ihm kaum mehr erinnerlichen Freunden das alljährlich die Festspiele präludierende "Weekend" zu begehen, eine orgiastische Feier im Kellergewölbe, zu der massenhaft Alkohol, Speisen sowie Prostituierte angeliefert werden. Von den spielerisch an "Das große Fressen" angelehnten Dionysien geht eine solche Faszination aus, dass der Erzähler - stets geneigt, sich überreden zu lassen - seine Kurzvisite immer weiter verlängert.
Der rauschhaften Ausgelassenheit eignet etwas Künstliches, alle Beteiligten scheinen eine Rolle zu spielen. Plötzlich jedoch bricht das Andere in diese selbstgefällige Welt ein. Ein ungebetener Gast taucht auf, ein Afrikaner, den man zunächst für einen Dealer hält, der sich aber als Bibelverkäufer erweist und, zum Hohn der Freunde, abstinent lebt. Max bricht einen Streit vom Zaun, greift den Fremden an - und von einem Moment auf den anderen ist aus dem Freundeskreis eine Schicksalsgemeinschaft geworden, verwandelt sich das Schloss in einen Kerker, denn das Opfer ist ja zugleich der einzige Zeuge der Tat. Der "afrikanische Freund", illegal im Land und bald aufs nackte Leben reduziert, ist so dem Richtspruch der Freunde ausgeliefert.
Diese spielen wie in Trance weiter ihr Spiel, das immer morbidere De-Sade-Züge annimmt und so den Fluch der bösen Tat, die fortzeugend Böses gebiert, dramaturgisch zu überwölben sucht. Die vier Personen reagieren sehr verschieden auf das Geschehene, als Kollektiv kennen sie keine Gnade. So läuft die Handlung auf einen düsteren Höhepunkt zu, einer der finstersten Momente in der jüngeren Literaturgeschichte. Gelich lockert seinen Griff nicht, verschmäht den auktorialen Notausgang. An der Seite der nicht unsympathischen Protagonisten gerät der Leser in eine Horrorwelt ohne jede Nächstenliebe. Natürlich steht der Roman damit unter Allegorieverdacht, erinnert die Handlung, wenn nach dem Recht des Stärkeren dem Opfer das erlittene Unrecht zum Vorwurf gemacht wird, an den Umgang des zivilisierten Westens mit dem afrikanischen Kontinent. In seiner postkolonialen Dimension aber geht Gelichs Requiem keineswegs auf. Der im Jahre 1969 in Salzburg geborene Autor - "Die Spur des Bibliothekars" (2003), "Chlor" (2006) - weitet sein Thema zu einer Analytik von Schuld und Unschuld jenseits aller metaphysischen Rückbindung: Decken sich Schuld und Unschuld, wenn die Idee von Sühne fortfällt? "Wo kein Kläger, da kein Richter", heißt es an einer entscheidenden Stelle.
Auf geradezu schmerzhaft indiskrete Weise wird der in Opportunismus und Utilitarismus sich erhaltende Naturzustand freigelegt. Die Gesetzlosen stehen noch einmal dem wehrlosen Gesetz gegenüber, das sie für illegal erklären. Der Erzähler, dieses unrettbare Ich, bleibt bewusst ohne Eigenschaften, ja, sogar ohne Namen: "Man hätte mich genauso gut aus dieser Geschichte entfernen und an meiner Stelle irgendjemand anderen setzen können. Markieren. Ausschneiden. Einfügen." Was wir vor uns haben, verdichtet auf ein ungeheuerliches und bildmächtiges Ereignis, ist auch eine moralische Geschichte, die nicht moralisiert.
Durch einen geschickten inszenatorischen Kniff - ein Theater im Theater - gibt Johannes Gelich seinem fesselnden, narrativ überzeugenden Kabinettstück eine unerwartete und fast christlich zu nennende Wendung. Bei der Eröffnung der Festspiele, dem Zielpunkt des "Weekend", wird traditionell "Jedermann" aufgeführt, in dem Gottvater den ihm gebührenden Respekt reklamiert. Der Erzähler, der "den Tod des Jedermann kaum erwarten kann", scheint von der Gnadenbotschaft übermächtigt. In Hofmannsthals Stück findet der vom Tod Bedrängte zum Glauben zurück und entgeht so der Hölle; der Erzähler beginnt "vor lauter Freude zu laufen".
OLIVER JUNGEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH