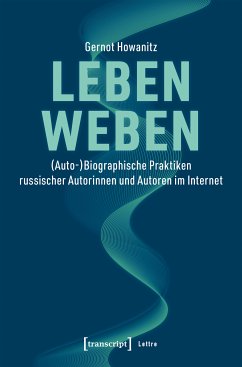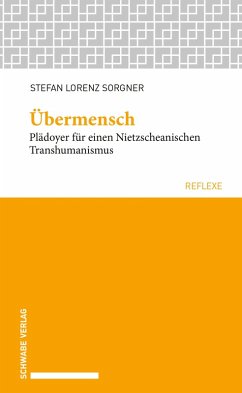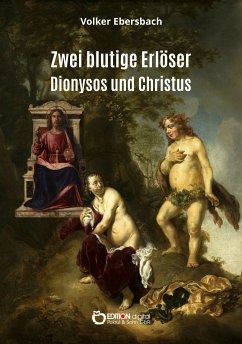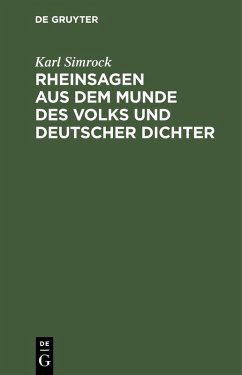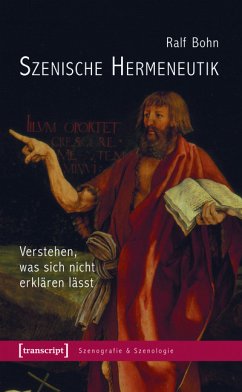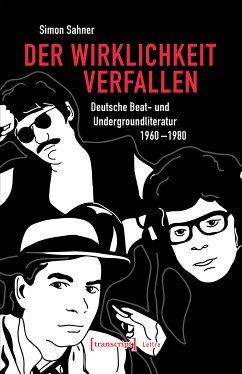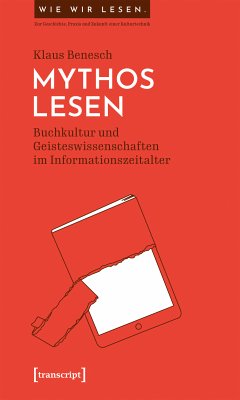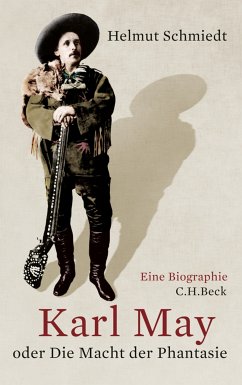Der Antichrist und der Gekreuzigte (eBook, PDF)
Friedrich Nietzsches letzte Texte
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
11,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wenige Monate vor seinem Zusammenbruch 1888/89 beginnt Friedrich Nietzsche die Geschichte Jesu von Nazareth auf verstörende Weise neu zu erzählen - ausgerechnet unter der Überschrift "Der Antichrist". Gleich darauf entwirft er seine Selbstdarstellung "Ecce homo" in enger Auseinandersetzung mit diesem Bild Jesu. Und in seinen letzten Briefen tritt er schließlich selbst in diese Erlöserrolle ein. Der Dichter-Philosoph, der einst den "Tod Gottes" proklamiert hatte, verkündet nun triumphierend: "Gott ist auf der Erde". Und er unterschreibt diesen Satz als "Der Gekreuzigte". Die Wandlungen, d...
Wenige Monate vor seinem Zusammenbruch 1888/89 beginnt Friedrich Nietzsche die Geschichte Jesu von Nazareth auf verstörende Weise neu zu erzählen - ausgerechnet unter der Überschrift "Der Antichrist". Gleich darauf entwirft er seine Selbstdarstellung "Ecce homo" in enger Auseinandersetzung mit diesem Bild Jesu. Und in seinen letzten Briefen tritt er schließlich selbst in diese Erlöserrolle ein. Der Dichter-Philosoph, der einst den "Tod Gottes" proklamiert hatte, verkündet nun triumphierend: "Gott ist auf der Erde". Und er unterschreibt diesen Satz als "Der Gekreuzigte". Die Wandlungen, die sich zwischen diesen Texten vollzogen haben, sind immer wieder als Symptome des ausbrechenden Wahnsinns verstanden worden. Detering analysiert Nietzsches letzte Texte jenseits der alten Streitigkeiten um Philosophie und Krankheit: als Teile einer sich vor den Augen der Leser entwickelnden großen Erzählung, als Arbeit am Mythos, die ihrer eigenen literarischen Logik folgt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.