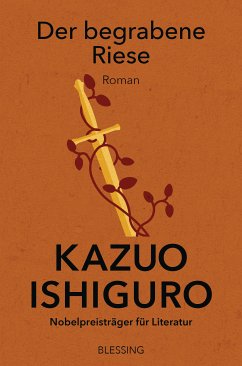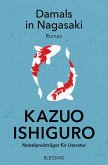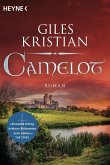Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Historisch und phantastisch: In seinem neuen Roman "Der begrabene Riese" sprengt Kazuo Ishiguro alle Gattungsgrenzen / Von Daniel Kehlmann
Manchmal könnte man eine Buchbesprechung kurz halten. Man müsste dann nur darauf hinweisen, dass man über einen bestimmten Roman am besten gar nichts wissen sollte, bevor man ihn liest. In Kazuo Ishiguros "Der begrabene Riese" liegt die Welt unter einem sich allmählich lichtenden Nebel, und ebendas ist auch sein Kompositionsprinzip: Für sich selbst allmählich herauszufinden, was hier eigentlich verhandelt wird, bildet das eigentliche Erlebnis dieser Lektüre. Wer also dem Rezensenten vertraut, sollte die Rezension an dieser Stelle beenden und lieber gleich "Der begrabene Riese" lesen.
Wer aber trotz dieser Warnung unbedingt mehr wissen will, zum Beispiel weil er längst beschlossen hat, dass er ohnehin kein Buch anrühren würde, in dem Drachen und magische Nebel vorkommen, dem kann man natürlich Auskunft geben. Man könnte so jemandem gleich erklären, dass "Der begrabene Riese" ein Ausflug des Autors von "Was vom Tage übrig blieb" und "Alles was wir geben mussten" in das Genre der Fantasyliteratur ist.
Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn "Der begrabene Riese" ist exakt an der Übergangsstelle zwischen historischem und phantastischem Erzählen angesiedelt, im England des sechsten Jahrhunderts. Aus dieser Epoche ist so gut wie nichts bekannt. Nach dem Abzug der Römer verfiel die Zivilisation auf den Britischen Inseln fast vollständig, die größeren Siedlungen wurden zu unbewohnten Ruinenstädten, und für fast dreihundert Jahre liegen so gut wie keine Aufzeichnungen vor - nirgendwo ist der Begriff dark ages so angebracht. Ein Roman, der in dieser Zeit spielt, ist also naturgemäß auf Phantasie angewiesen, und wer sich auf das Weltbild der Menschen der Epoche ernsthaft einlässt, muss von Geistern, Dämonen und archaischen Naturwesen erzählen. In einer von solchen Wesen erfüllten Welt bricht also das alte Ehepaar Axl und Beatrice auf, um ihren Sohn zu finden, der vor Zeiten die kleine Siedlung verlassen hat und nie zurückgekommen ist.
Aber ein Nebel liegt auf dem Land, den keine Sonne durchdringt, und er bewirkt Vergessen. Haben die beiden wirklich einen Sohn gehabt? Ganz sicher sind sie nicht. Und wenn ja, wo ist er eigentlich hin? Verschwommen erinnern sie sich, dass etwas passiert ist, aber sie vermögen nicht, der Sache auf den Grund zu gehen. Verwirrt ziehen sie von Siedlung zu Siedlung, immer in Angst vor jenen Wesen, die nachts die Wälder unsicher machen, und treffen Menschen, die wie sie verwirrt, verloren, ohne Gedächtnis sind. Sie treffen auch einen alten Ritter, der behauptet, Gawain zu heißen, vor Zeiten dem großen Artus gedient zu haben und auf der Suche nach einem Drachen zu sein, der schuld an dem Nebel, dem Vergessen und der Misere ist, die das Land befallen hat.
So weit, so spannend, aber das Grandiose ist, wie Ishiguros Roman alle Gattungsgrenzen sprengt und das, was gerade noch sicher schien, nach und nach fraglich macht. Denn der Ritter, der den Drachen töten will, will womöglich in Wahrheit etwas anderes, und Axl, der einfache Alte, der von großen Dingen nichts weiß, ist womöglich das Gegenteil von dem, was er scheint, und sogar mit dem Drachen, der in einer kurzen Szene wirklich sichtbar wird, verhält es sich offenbar ganz anders. Vor allem aber ist der die Erinnerungen löschende Nebel womöglich nicht der Fluch, als der er zu Beginn erschienen ist. Aber ist es nicht ein Axiom, dass Literatur für die Erinnerung und gegen das Vergessen steht? Wer würde es wagen, diesem Satz zu widersprechen und das Vergessen zu verteidigen?
Nun, Ishiguros Roman wagt es. Sehr spät erst findet der Leser heraus, dass vor nicht allzu langer Zeit ein Bürgerkrieg stattgefunden hat und dass all die verlorenen Menschen Überlebende sind. Der große Nebel war für sie kein Fluch, er hat ihnen vielmehr das Weiterleben ermöglicht; nur dadurch, dass sie die Schrecken, die sie ihren Nachbarn und diese ihnen angetan haben, völlig vergessen haben, war es ihnen möglich, nebeneinander weiterzuleben. Wird nun, da dieser Nebel sich lichtet, die Wahrheit sie frei machen, oder wird sie vielmehr neue Grausamkeiten, neues Blutvergießen und neue Schrecken bringen? Nietzsches These, dass jede Zivilisation auf verdrängter Barbarei aufbaut, bekommt bei Ishiguro neue Dringlichkeit - der begrabene Riese des Titels ist kein Fabelwesen, sondern eine Metapher für verdrängtes Blutvergießen -, und die Frage, ob eine Gesellschaft Täter lieber verfolgen oder vergessen und weitermachen soll, als wäre nichts geschehen, rückt plötzlich in den Mittelpunkt eines Romans, der doch gerade noch so weit entfernt von unseren Tagen zu spielen schien.
Aber "Der begrabene Riese" ist keine Allegorie - im Gegenteil, der Roman ist reich, vieldeutig und so rätselhaft wie ein Traum, und seine Figuren sind keine Marionetten, sondern psychologisch komplex und widersprüchlich. Das gilt besonders für den Ritter Gawain, zunächst scheinbar ein Wiedergänger des Ritters von der traurigen Gestalt, in Wahrheit aber der klarste Geist von allen. Am meisten aber gilt es für die beiden Alten, Axl und Beatrice, die nach einem Leben in tiefster Verbundenheit herausfinden müssen, dass auch ihre Erinnerung sie womöglich getäuscht hat und dass nicht nur der Staat, sondern auch die Liebe nach ständigem Vergessen und immer neuen Lügen über die Vergangenheit verlangt. Aber sobald die beiden, und mit ihnen der Leser, das begriffen haben, sind sie auch schon im letzten Kapitel und in der seltsamsten und schönsten Todesszene angelangt, die es in der Weltliteratur der letzten Jahre gegeben hat. Ja, verlangt das Klischee denn nicht auch, dass Liebe stärker sein muss als der Tod? Bei Ishiguro ist das umgekehrt, und der simple Umstand, dass jeder Charons Boot allein besteigen muss, führt zu einer Schlussszene, auf die man wohl ausnahmsweise und in aller Vorsicht das überbeanspruchte Wort "unvergesslich" anwenden kann.
Leider kann man aber auch getrost voraussagen, dass so manche Leser, die dieses Meisterwerk schätzen könnten, einen Bogen darum machen werden, weil sie nun einmal beschlossen haben, dass sogenannte Fantasy unter ihrer Würde ist. Sei's drum, es ist ihr eigener Verlust. Sie werden nie erfahren, was sie versäumen, und "Der begrabene Riese" wird, wie schon einst "Der Herr der Ringe", als Geheimtipp auf die Bestsellerlisten verschwinden.
Kazuo Ishiguro: "Der begrabene Riese". Roman.
Aus dem Englischen von Barbara Schaden. Blessing Verlag, München 2015. 416 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main