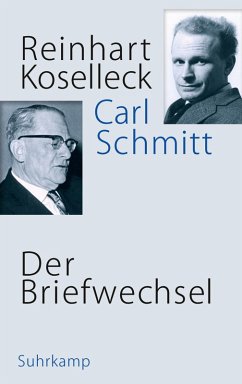Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Der Briefwechsel des Historikers Reinhart Koselleck mit dem Staatsrechtler Carl Schmitt ist ein ideengeschichtliches Dokument ersten Ranges.
Die Geheimdiplomatie öffentlicher Machthaber ist ein harmloses Spiel im Vergleich zu der öffentlichen Diplomatie geheimer Machthaber. Ein Satz aus der 1928 erschienen "Verfassungslehre" des Staatsrechtlers Carl Schmitt über die Dialektik des Absolutismus half dem Heidelberger Doktoranden und späteren Bielefelder Historiker Reinhart Koselleck Anfang der fünfziger Jahre, den geschichtlichen Ursprung des Weltbürgerkrieges zu entschlüsseln, dem er nach Ostfront, Verwundung und sowjetischer Kriegsgefangenschaft noch einmal entkommen war: Der Keim des ideologischen Terrors ist die Trennung des moralischen Räsonnements von der staatlichen Politik durch die bürgerliche Gesellschaft des achtzehnten Jahrhunderts.
Dass Kosellecks legendäre Dissertation "Kritik und Krise" von 1954 ihre zentrale These der Hobbes-Interpretation Schmitts verdankt, war bekannt. Wie sehr die originelle Anverwandlung schmittianischer Kategorien seine Historik insgesamt geformt hat, zeigt sein Briefwechsel mit Schmitt, der jetzt in einer vorzüglichen Edition vorliegt, die heute erscheint. Dieser Austausch zweier herausragender Gestalten des historisch-politischen Denkens im zwanzigsten Jahrhundert ist ein ideengeschichtliches Dokument ersten Ranges.
Begegnet waren sie sich in jenem Heidelberg der Nachkriegszeit, das Kosellecks Studienfreund Nicolaus Sombart in narzisstischen, aber nicht zuletzt wegen eines kunstvollen Koselleck-Porträts lesenswerten Erinnerungen ("Rendezvous mit dem Weltgeist") beschrieben hat. Wo mit Alfred Weber oder Karl Jaspers noch die Zwischenkriegszeit den Ton angab, suchte die Generation der Überlebenden und Kriegsheimkehrer nach Antworten auf das Erlebte.
Im ersten und zugleich bedeutendsten Brief des Bandes erinnert Koselleck sich an Schmitts Ermahnung, "die Begriffe im Zuge ihrer Klärung stets auf die ihnen entsprechende Situation zurückzuführen". Er antwortet darauf, indem er nicht weniger als ein Arbeitsprogramm seines Lebens entwirft.
Jahre bevor Schmitt selbst über die "Tyrannei der Werte" schreiben würde, zerlegt Koselleck das historistische Programm einer "Relativierung" der Werte: Zu tief sei der Historismus in die bürgerlichen Geschichtsphilosophien der Neuzeit verstrickt. Man sollte, setzt Koselleck dem entgegen, "endlich durchstoßen zu einer Geschichtsontologie, die nicht mehr methodisch letzte Auskunft ist, sondern der Anfang einer Begriffsbildung, die es ermöglicht, den Geschichtsphilosophien das Wasser abzugraben, und somit eine Antwort auf unsere konkrete Situation darstellen kann".
Der Ursprung der Geschichte
Die Geschichte ist bei Koselleck kein Prozess, der Ursprung und Ziel seiner selbst verbindet. Der Ursprung der Geschichte geht weiter, solange es Geschichte gibt. "Die Endlichkeit des geschichtlichen Menschens" selbst ist nämlich dieser "dauernde Ursprung der Geschichte". Der vorzügliche, ungemein nuancierte, aber nie geschwätzige Kommentar des Herausgebers Jan Eike Dunkhase verrät, was Carl Schmitt an den Rand dieser Briefstelle schrieb: "das ist es".
Warum teilt der junge Koselleck, der dieses Programm einer anderen Historik mit seinen Untersuchungen zur Gesellschafts- und Begriffsgeschichte oder zum Erfahrungswandel bald einlösen sollte, all dies ausgerechnet Carl Schmitt mit? Er glaubte Schmitt viel mehr als nur eine Deutung des Absolutismus zu verdanken: Ihm, nicht Jaspers oder Heidegger, schrieb er den gelungenen Sprung der Historiographie aus dem Historismus zu. In seinem Essay "Land und Meer" (1942) und dann vor allem in seinem 1950 erschienenen "Nomos der Erde" hatte Schmitt das liberale Völkerrecht der Neuzeit als planetarische Raumordnung der europäischen Kolonialmächte gedeutet und kurz darauf die historische Analyse ökonomischer Ordnungsmodelle jenseits marxistischer Geschichtsdialektik skizziert ("Nehmen - Teilen - Weiden").
Während die akademische Rechtswissenschaft diese Texte ein halbes Jahrhundert lang ignorierte, sah Koselleck ihre Bedeutung sofort. Als Anbiederung beim berüchtigten NS-Staatsrat wird diese Briefe darum nur lesen, wem die fundamentale Abhängigkeit der Fragestellung Kosellecks von Schmitt und Heidegger moralisch verdächtig ist.
Damit sind die Themen des Briefwechsels für ein Jahrzehnt gesetzt: Geschichtsphilosophie und Moral, Industrialisierung, Fortschritt und Utopie, die europäische Nachkriegsordnung und der Weltgegensatz von Ost und West, die Seemächte England und Amerika, die Landmächte Russland und China.
Immer wieder gelingen Koselleck stupende Beobachtungen und Deutungen, so in einem Brief im Januar 1957 über die weltpolitische Logik des Wirtschaftswunders: "In dem gegenwärtigen Nahme qua Gabe-Kampf liegen für Deutschland ungeheure Möglichkeiten. Es ist sicher sehr diffizil, sich als Politiker in dem Gestrüpp der Heterogonie von Geben und Nehmen zurechtzufinden. Wer gibt, nimmt, wer annimmt, gibt sich auf. Wer gibt, dem wird gegeben; Wer gibt, dem wird genommen. Wer nimmt, dem wird gegeben. Wer nimmt, gibt. Wer nimmt, gibt dem andern auf. . . . Jedenfalls hat Deutschland, dessen Ruf mehr nolens als volens in Afrika und Asien noch unlädiert ist, große Chancen, durch rechte Dosierungen in dem Gabe-Nahmespiel an Einfluß zu gewinnen. Und wenn man die Klugheit besäße, die Asiaten durch unsere Hochschulen zu schleusen, dann könnte man geradezu mit homöopathischen Dosen hundertfachen Effekt erzielen. Aber wer ist für diesen Punkt im föderalen Deutschland zuständig?"
Antisemitismus in Andeutungen
An Schmitt erprobt Koselleck Theorien, testet Hypothesen, berichtet von Lektüren und entwickelt Themen. Mit einer gedrängten Spekulation zur europäischen Großraumordnung des Wiener Kongresses legt Koselleck offen, wie groß die Lücke ist, die im "Nomos der Erde" im neunzehnten Jahrhundert klafft: "Mit den wechselnden Gegebenheiten wechselt die Legitimität, die Revolution wird in den Begriff mit eingebaut, und man könnte fast sagen: der Begriff steht schon an der Grenzscheide zwischen Geschichtsphilosophie und Historismus. - Der Wiener Kongress ist als ,Modell' viel aktueller als die französische Revolution. Die Katastrophe ist vorbei, und die Aufgabe besteht darin, die absehbaren Folgen in den Griff zu bekommen."
Etliche ungeschriebene Koselleck-Bücher lernt man auf diese Weise kennen. Während seiner Zeit als Lecturer in Bristol entwirft er ein Projekt über die Demokratisierung Englands und das Empire. Ein anderes zur Rolle der amerikanischen Revolution für das Selbstverständnis Englands im neunzehnten Jahrhundert. Ein drittes über Karl Marx und Benjamin Disraeli. Eher untergründig und allenfalls in Andeutungen über solche Namen wird auch Schmitts nach 1945 völlig unverminderter Antisemitismus zum Thema, den Koselleck vor der Veröffentlichung von Schmitts Tagebüchern kaum richtig einschätzen konnte.
Warum gab es in Deutschland keinen Disraeli?, fragt er sich. Schmitt antwortet mit einer Denksportaufgabe: Deutschland besitze nur zwei halbe Disraelis. Koselleck weiß die Antwort natürlich, auf die Schmitt hinauswill, und nennt den preußischen Konservativen Friedrich Julius Stahl und den Industriellen und Politiker Walther Rathenau. Das Rätsel scheint richtig gelöst, Schmitt geht nicht mehr darauf ein.
Nach einer Zeit der wachsenden Distanz gewinnt der Briefwechsel in den siebziger Jahren - Koselleck arbeitet inzwischen an den Texten, die 1979 in dem Band "Vergangene Zukunft" erschienen - wieder an Intensität. Ihn beschäftigt neben Schmitts ästhetischen Frühschriften jetzt vor allem der "Begriff des Politischen". In einem eindrucksvollen Brief von 1975 schildert er seine Beobachtungen zur Ikonologie der Kriegerdenkmäler und verknüpft sie mit einer explizit antitotalitären Interpretation der Freund-Feind-Unterscheidung: Feindschaft ist keine Abwertung, Freund und Feind sind die einzigen symmetrischen Gegenbegriffe der Geschichte. "Die rationale Anerkennung des Feindes ist wohl die einzige Einstellung in der Politik, die nicht utopisch werden kann."
Die Ereignisse, die zwischen den Quellen liegen, sind, wie immer, nicht überliefert. Vieles verweist vor oder zurück auf lange Gespräche in Plettenberg, über deren Intensität Koselleck in einem dem Band beigegebenen Interview berichtet. Auf die Erkenntnis, dass sich das Gespräch zwischen den beiden herausragenden Theoretikern der indirekten Gewalt des Geheimnisses auch durch die beste Edition nicht ganz veröffentlichen lässt, ist man nach der Lektüre aber gut vorbereitet.
FLORIAN MEINEL
Reinhart Koselleck
und Carl Schmitt:
"Der Briefwechsel 1953-1983".
Hrsg. von Jan Eike
Dunkhase.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 459 S., geb., 42,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main