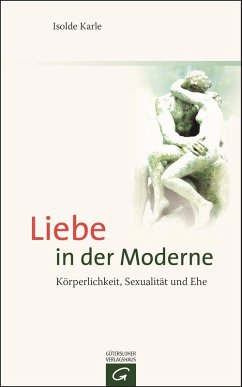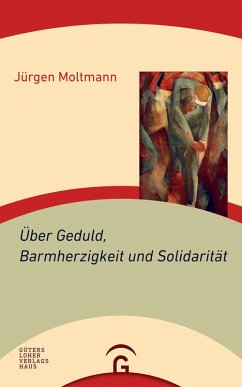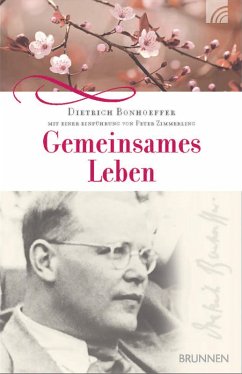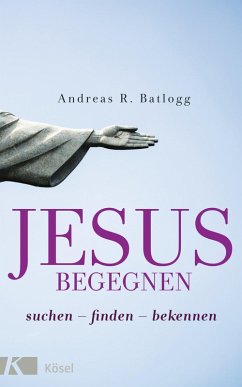Der christliche Glaube (eBook, ePUB)
Eine evangelische Orientierung;
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,99 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Dem Evangelium treu, den Menschen nah, der Zukunft zugewandt. - Für die, die religiöse Orientierung suchen und das Zweifeln nicht verlernt haben - Ein sehr persönliches Buch über den Glauben als Lebenshaltung in der Welt - Eine evangelische Orientierung - Protestantismus für die Gegenwart
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.