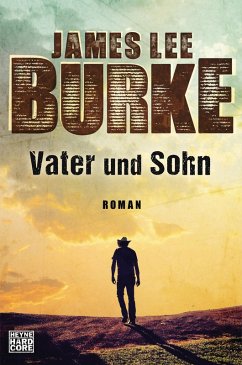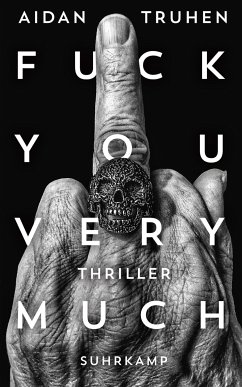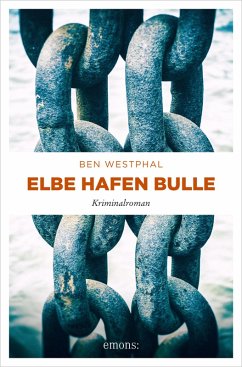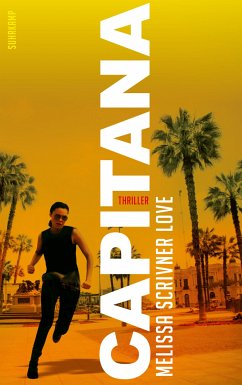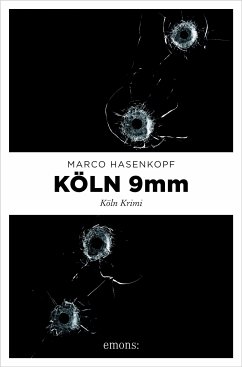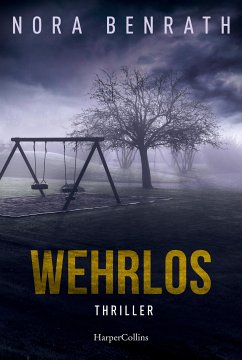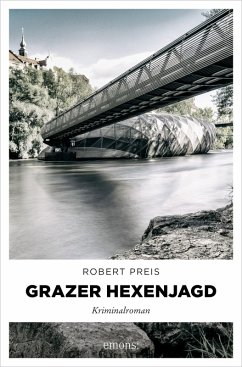Der die Träume hört (eBook, ePUB)
Kriminalroman
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,00 €**
8,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nizar Benali hat es geschafft. Er hat Westmarkt verlassen, wo er unter "Schwarzköpfen" aufgewachsen ist und wo Drogenhandel und Schutzgelderpressung ¿orieren. Er arbeitet als Privatermittler für Cyberverbrechen und wird beauftragt, den Darknet-Dealer Toni_meow aus¿ndig zu machen, an dessen Stoff ein Teenager gestorben ist. Das scheint zunächst ein gut bezahlter, wenn auch aussichtsloser Job. Doch dann präsentiert ihm eine alte Liebschaft ihren siebzehnjährigen Sohn Lesane - ihren gemeinsamen Sohn. Lesane treibt sich in Westmarkt herum, er dealt und hat Schulden. Nizar ahnt, dass Toni_me...
Nizar Benali hat es geschafft. Er hat Westmarkt verlassen, wo er unter "Schwarzköpfen" aufgewachsen ist und wo Drogenhandel und Schutzgelderpressung ¿orieren. Er arbeitet als Privatermittler für Cyberverbrechen und wird beauftragt, den Darknet-Dealer Toni_meow aus¿ndig zu machen, an dessen Stoff ein Teenager gestorben ist. Das scheint zunächst ein gut bezahlter, wenn auch aussichtsloser Job. Doch dann präsentiert ihm eine alte Liebschaft ihren siebzehnjährigen Sohn Lesane - ihren gemeinsamen Sohn. Lesane treibt sich in Westmarkt herum, er dealt und hat Schulden. Nizar ahnt, dass Toni_meow zu ¿nden die einzige Möglichkeit sein könnte, Lesane vor dem endgültigen Absturz zu retten. Ein Roman über sozialen Aufstieg und was man dabei verliert. Über den tristen Glamour der Straße. Über Drogenhandel 2.0, der auch auf den vermeintlich cleanen Plattformen des Darknets ein schmutziges Geschäft bleibt - und über verlorene Söhne, die es einmal besser haben sollten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deHarter Stoff. Und zwar sowohl der Gegenstand des Romans als auch die Schreibweise des Autors. Drogen, Rapmusik, Kiezsprache?… Wer Selim Özdogans ersten Krimi „Der die Träume hört“ liest, lässt sich auf eine Tour de Force durch eine Welt ein, die den meisten Lesern ferner sein dürfte, als alles, was sich in amerikanischen oder schwedischen Krimis so abspielt. So richtig sympathisch sind einem Selim Özdogans Figuren nicht, dafür lassen sie bisweilen einen tiefen Blick hinter die Fassade des harten, coolen Typen zu, allerdings immer nur für einen Moment, bis sich der Riss in der Fassade wieder schließt. Der Ermittler Nizar Benali hat es scheinbar geschafft, dem Milieu zu entkommen und eine fast schon bürgerliche Existenz aufzubauen, doch eine anfangs unverfängliche Ermittlung und die Begegnung mit dem Sohn, von dem er nichts wusste, zieht ihn zurück in die Abgründe mit den Dämonen der Vergangenheit. Dabei geben die Beats der unablässig erwähnten Rap-Stücke das Erzähltempo weitestgehend vor und erzeugen damit auch einen gewissen Sog, dem man sich nicht entziehen kann, wenn man sich erst mal auf diese Erzählweise eingelassen hat. Das ist durchaus Geschmackssache und nicht unbedingt massenkompatibel, aber das will Özdogans Buch in seiner Radikalität wohl auch gar nicht sein.
buecher-magazin.deHarter Stoff. Und zwar sowohl der Gegenstand des Romans als auch die Schreibweise des Autors. Drogen, Rapmusik, Kiezsprache?… Wer Selim Özdogans ersten Krimi „Der die Träume hört“ liest, lässt sich auf eine Tour de Force durch eine Welt ein, die den meisten Lesern ferner sein dürfte, als alles, was sich in amerikanischen oder schwedischen Krimis so abspielt. So richtig sympathisch sind einem Selim Özdogans Figuren nicht, dafür lassen sie bisweilen einen tiefen Blick hinter die Fassade des harten, coolen Typen zu, allerdings immer nur für einen Moment, bis sich der Riss in der Fassade wieder schließt. Der Ermittler Nizar Benali hat es scheinbar geschafft, dem Milieu zu entkommen und eine fast schon bürgerliche Existenz aufzubauen, doch eine anfangs unverfängliche Ermittlung und die Begegnung mit dem Sohn, von dem er nichts wusste, zieht ihn zurück in die Abgründe mit den Dämonen der Vergangenheit. Dabei geben die Beats der unablässig erwähnten Rap-Stücke das Erzähltempo weitestgehend vor und erzeugen damit auch einen gewissen Sog, dem man sich nicht entziehen kann, wenn man sich erst mal auf diese Erzählweise eingelassen hat. Das ist durchaus Geschmackssache und nicht unbedingt massenkompatibel, aber das will Özdogans Buch in seiner Radikalität wohl auch gar nicht sein.