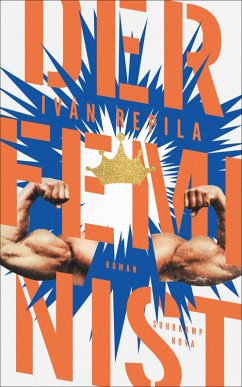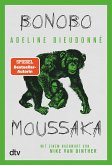Bevor er sich in Najwa verliebt, hat er keinen blassen Schimmer vom Feminismus. Er ist ein 08/15-Typ mit den üblichen Vorurteilen, blinden Flecken, problematischen Verhaltensweisen. Aber bei ihr geht er in eine harte Schule. Sein Blick auf die Welt verändert sich: Beeinträchtigungen, Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen sind plötzlich überall, genau wie die Paradoxien und der Unmut, der ihm entgegenschlägt, sobald er nur wieder irgendwo vom grausamen Patriarchat anfängt. Wie kann er die Frauen in diesem Kampf am besten unterstützen? Ein Wutanfall seiner Mutter bringt ihn auf eine folgenschwere Idee.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH