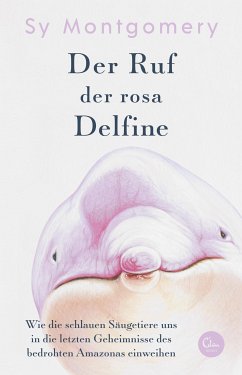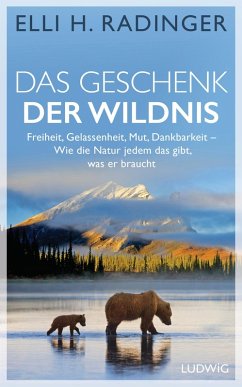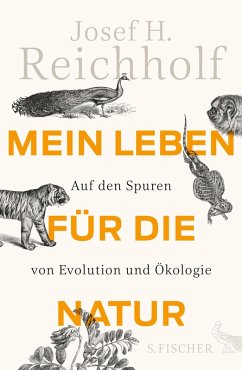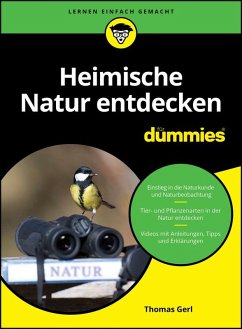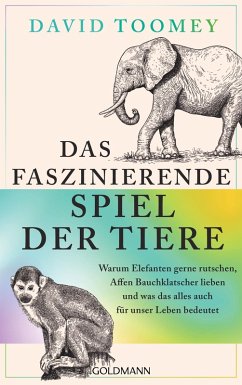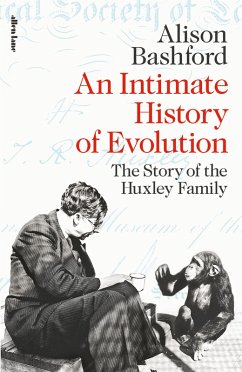Der Geschmack von Laub und Erde (eBook, ePUB)
Wie ich versuchte, als Tier zu leben
Übersetzer: Schermer-Rauwolf, Gerlinde; Weiß, Robert A.
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 16,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was fühlt ein Tier, wie lebt es und wie nimmt es seine Umwelt wahr? Um das herauszufinden, tritt Charles Foster ein faszinierendes Experiment an. Er schlüpft in die Rolle von fünf verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler. Er haust in einem Bau unter der Erde, schnappt mit den Zähnen nach Fischen in einem Fluss und durchstöbert Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung. Er schärft seine Sinne, wird zum nachtaktiven Lebewesen, beschreibt wie ein Weinkenner die unterschiedlichen »Terroirs« von Würmern und wie sich der Duft der Erde in den verschiedenen Jahresz...
Was fühlt ein Tier, wie lebt es und wie nimmt es seine Umwelt wahr? Um das herauszufinden, tritt Charles Foster ein faszinierendes Experiment an. Er schlüpft in die Rolle von fünf verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler. Er haust in einem Bau unter der Erde, schnappt mit den Zähnen nach Fischen in einem Fluss und durchstöbert Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung. Er schärft seine Sinne, wird zum nachtaktiven Lebewesen, beschreibt wie ein Weinkenner die unterschiedlichen »Terroirs« von Würmern und wie sich der Duft der Erde in den verschiedenen Jahreszeiten verändert. In die scharfsinnige und witzige Schilderung seiner skurrilen Erfahrungen lässt er wissenswerte Fakten einfließen und stellt sie in den Kontext philosophischer Themen. Letztendlich geht es dabei auch um die eine Frage: Was es bedeutet, Mensch zu sein.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deCharles Foster hat versucht, das Leben von Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler nachzustellen. Er grub einen Bau in die Erde, jagte Fische mit den Zähnen und labte sich am Weggeworfenen der Menschen. Seine Erfahrungen als Tier und sein Wissen als Tierarzt und Rechtsanwalt hat er in diesem faszinierenden Buch ausgebreitet - ein Kompendium biologischen, physikalischen und chemischen Wissens. Eine Zusammenstellung von Sinneseindrücken, wie man als Tier seine Umwelt tief in der Erde, im Wasser oder in der Luft erlebt. Mit diesem Buch lernt man mehr über Naturgeschichte, Neurowissenschaften und Psychologie als in zwölf Jahren Schulunterricht. Vor allem lernt man sich als Mensch neu kennen: mit seinem tierischen Erbe, mit seinen Begrenzungen, aber auch mit all den Möglichkeiten, die anderen Tieren nicht zur Verfügung stehen. Es liest Wanja Mues: Der Schauspieler mit der angenehmen Stimme liest zurückhaltend, prägnant, präzise - und tritt hinter Fosters Erfahrungen, Gedanken und Überlegungen zurück. Und gerade dadurch zieht er uns in tierische Verhältnisse, in das Leben dieser Tiere, in die Natur.
buecher-magazin.deCharles Foster hat versucht, das Leben von Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler nachzustellen. Er grub einen Bau in die Erde, jagte Fische mit den Zähnen und labte sich am Weggeworfenen der Menschen. Seine Erfahrungen als Tier und sein Wissen als Tierarzt und Rechtsanwalt hat er in diesem faszinierenden Buch ausgebreitet - ein Kompendium biologischen, physikalischen und chemischen Wissens. Eine Zusammenstellung von Sinneseindrücken, wie man als Tier seine Umwelt tief in der Erde, im Wasser oder in der Luft erlebt. Mit diesem Buch lernt man mehr über Naturgeschichte, Neurowissenschaften und Psychologie als in zwölf Jahren Schulunterricht. Vor allem lernt man sich als Mensch neu kennen: mit seinem tierischen Erbe, mit seinen Begrenzungen, aber auch mit all den Möglichkeiten, die anderen Tieren nicht zur Verfügung stehen. Es liest Wanja Mues: Der Schauspieler mit der angenehmen Stimme liest zurückhaltend, prägnant, präzise - und tritt hinter Fosters Erfahrungen, Gedanken und Überlegungen zurück. Und gerade dadurch zieht er uns in tierische Verhältnisse, in das Leben dieser Tiere, in die Natur.