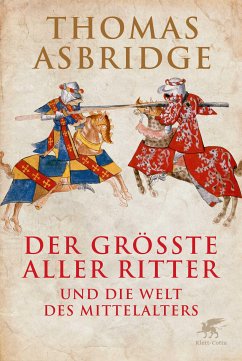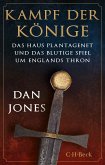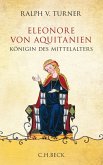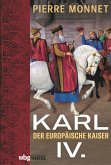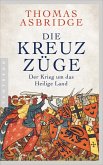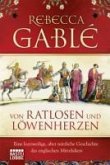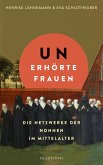Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Er diente fünf Königen und machte damit ein Vermögen: Thomas Asbridge erzählt die Lebensgeschichte des vorbildlichen Ritters Guillaume le Maréchal.
Von Andreas Kilb
In Anthony Harveys Filmklassiker "Der Löwe im Winter" ist er eine Nebenfigur im Schatten von Katharine Hepburn und Peter O'Toole, ein verlässlicher Haudegen am Hof Heinrichs II. von England: William Marshal, auch Guillaume le Maréchal genannt, der erste Earl of Pembroke, eine Säule der Plantagenet-Dynastie, zu der Richard Löwenherz und Johann Ohneland gehörten, und eine mythische Gestalt des mittelalterlichen Rittertums. Als "besten aller Ritter" hat ihn sein französischer Biograph Georges Duby gefeiert; Thomas Asbridge, der eine lange Tradition angelsächsischer Marshal-Publizistik fortsetzt, nennt ihn den "größten" seines Stands.
Wie immer man nun, sei es nach vierhundertfünfzig Seiten Asbridge-Lektüre oder als Tourist an Marshals Grab in der Londoner Temple Church, die martialischen oder moralischen Qualitäten des Recken auch einschätzen mag, er bleibt eine Symbolfigur, in der wie in einem Brennspiegel die Projektionen und Sehnsüchte seines Zeitalters zusammenfließen. Die mit Abstand wichtigste Quelle zu William Marshals Leben sind die mehr als neunzehntausend in anglonormannischer Sprache verfassten Verse der "Histoire de Guillaume le Maréchal", die ein anonymer Autor in den zwanziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts im Auftrag von Marshals gleichnamigem Sohn komponierte. Im Vorwort erzählt Asbridge die Geschichte ihrer Wiederauffindung. Es ist das spannendste Kapitel seines Buchs. Denn die "Histoire" war, begünstigt durch das rasche Erlöschen von Marshals Familie (sein letzter männlicher Nachfahre starb 1245), bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein verschollen. Erst 1861 entdeckte sie der französische Philologiestudent Paul Meyer unter den Losen einer Auktion bei Sotheby's.
Meyer versuchte das Manuskript zu ersteigern, unterlag aber einem englischen Sammler, der sie in seiner Bibliothek verschwinden ließ. Zwei Jahrzehnte später fand der Franzose sie nach langer Suche wieder, und dann dauerte es noch einmal zehn Jahre, bis der erste Band von Meyers Edition der Handschrift herauskam. Der dritte und letzte erschien 1901.
Asbridge zitiert die letzten Verse der "Histoire", in denen der Autor den Ritter der Gnade Gottes empfiehlt: "Ci fini del conte lestoire / Et des en perdurable gloire / Vont que la sue ame seit mise / Et entre ses Angles assise. Amen." Es ist das einzige Originalzitat, das Asbridge seinen Lesern gönnt. Georges Duby dagegen lässt, wo es um Turniere und das Waffenhandwerk geht, in seinem Buch von 1984 die "Histoire" - in moderner Übersetzung - seitenlang selbst sprechen. Das müsste uns nicht weiter beschäftigen, wenn Asbridge in einer Fußnote nicht ausdrücklich von Dubys "überspannter" Studie (die er kurioserweise auf 1940 datiert) abraten würde. Die abschätzige Bemerkung fordert eine Gegenüberstellung geradezu heraus. Wir haben also verglichen, und das Ergebnis fällt nicht zugunsten von Thomas Asbridge aus.
Der Londoner Mediävist hat wissenschaftlich vorbildlich gearbeitet, er kennt die neueste ebenso wie die ältere Forschungsliteratur. Und auch in erzählerischer Hinsicht lässt sein Buch wenig zu wünschen übrig: Marshals Kindheit, seine Geiselhaft am Hof des englischen Königs Stephan von Blois, die Lehrjahre des jungen William - bei Asbridge heißt er, wie bei seinen Zeitgenossen, Guillaume -, die Dienste, die er nacheinander fünf Plantagenet-Königen leistete, seine Rolle bei der Abfassung der Magna Carta, sein Sieg als Heerführer in der Schlacht von Lincoln, seine Regentschaft und sein Tod, das alles wird penibel und gelegentlich auch unterhaltsam ausgebreitet.
Aber etwas Entscheidendes, das, was der deutsche Untertitel seines Buchs verspricht ("und die Welt des Mittelalters"), bleibt Asbridge schuldig. Er schildert ein Leben in allen Einzelheiten, aber keine Welt. Gut sieben Jahrzehnte, von 1147 bis 1219, umspannt die Biographie des William Marshal. In diese Zeit fallen der große Kampf zwischen Papst und Kaiser um die Vorherrschaft in Europa, die Blütezeit der Troubadoure, der Bau der ersten gotischen Kathedralen, die frühe Scholastik, die Reconquista in Spanien, die erste Eroberung Konstantinopels, der Aufstieg Venedigs zur Handelsgroßmacht. Fast nichts davon erfährt man bei Asbridge. Weil er sich ganz auf die Geschichte seines Helden konzentriert, entgeht ihm deren geschichtliche Dimension. Denn William Marshal alias Guillaume le Maréchal war eine Figur des Übergangs. Indem er in Tat und Wort das Hergebrachte vertrat und jedem seiner fünf königlichen Herren bis zur Selbstverleugnung diente, nahm er teil am Verwandlungsprozess seiner Epoche.
Sein Name steht an erster Stelle der englischen Grafen in der Magna Carta, der Vorläuferin aller Staatsverfassungen des Abendlands. Als er geboren wurde, war Jerusalem noch in christlicher Hand; als er starb, machte sich Dschingis Khan gerade daran, sein Großreich nach Persien auszudehnen. Bei Asbridge scheint Marshal unter einer Glasglocke zu stecken, die einzig durch die Intrigen zwischen Vater und Sohn, König und Prinz, dem Haus Anjou und Frankreichs Herrschern erschüttert wird. Sein Film ist ein Kammerspiel, kein historisches Drama.
Eine Episode mag den Unterschied zwischen Duby und Asbridge im Blick auf ihr Thema verdeutlichen. Als der Turnierritter Guillaume von einem Gegner gefangen wird, verlangt dieser als Gegenleistung für seine Freilassung das Geld, das Prinz Heinrich, Guillaumes Herr, ihm schuldet. Guillaume kann nicht zahlen und muss für Heinrich hinter Gitter. Für Duby ist das der Punkt, an dem das ritterliche Ideal an der Realität zerbricht. Das Turnier, das Schaufenster des Rittertums, wird zum Geschäftsmodell. Asbridge dagegen rügt den "chronischen Materialismus", den sein Held in der Folge an den Tag legt. Der eine fällt ein moralisches Urteil. Der andere zeigt, wie die Moral in den Menschen selbst scheitert. Das ist nicht überspannt, sondern klug.
Thomas Asbridge: "Der größte aller Ritter und die Welt des Mittelalters".
Aus dem Englischen von Susanne Held. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2015. 487 S., Abb., geb, 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main