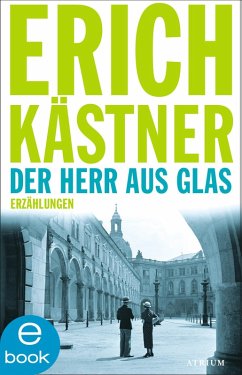Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Erich Kästner hielt viel auf seinen Witz. In den besten Stücken eines Bands mit bislang wenig bekannten Erzählungen des Autors ist diese Begabung zu spüren.
Obwohl es genügend andere Gründe gäbe - den Verlust der Geliebten und den Selbstmord des Freundes, die Entlassung aus der Redaktion, nicht zuletzt den ausdauernden nächtlichen Genuss der Berliner Club-Kultur -, kommt Erich Kästners Romanheld Fabian doch durch einen Zufall und sein gutes Herz zu Tode. Man kann auch sagen: Er stirbt an einer Pointe. Fabian springt von einer Brücke, um ein Kind zu retten. "Der kleine Junge schwamm heulend ans Ufer. Fabian ertrank. Er konnte leider nicht schwimmen." Der Retter ertrinkt, der Ertrinkende rettet sich. Die Pointe ist über Kreuz angelegt, hat die Form eines Chiasmus. Die dazu passende Überschrift verkündet trocken: "Lernt schwimmen!"
Wir wissen nicht, ob Walter Benjamin, der unerbittliche Kritiker von Kästners Lyrik, sich auch dazu geäußert hat. Man könnte es sich ausmalen. Von einem seriösen Roman darf man jedenfalls ein anderes Finale erwarten - so wie es Wolfgang Koeppen in seinem Roman "Das Treibhaus" dem Abgeordneten Keetenheuve zukommen lässt, einem schwerblütigen Nachfolger Fabians, der ausgerechnet am Bonner Nachtleben zugrundegeht: "und ein Sprung von dieser Brücke machte ihn frei". Das ist ein letzter Satz, der offen Schillers "Wilhelm Tell" zitiert, stillschweigend aber auch auf Fabian anspielt und diesen zum puren Luftikus herabstuft. Kann aber sein, dass Kästner dazu eine Formel aus seiner "großdeutschen Kunstlehre" eingefallen wäre: "Es schwimmt der Held im eignen Blut? Ende schlimm - alles gut!"
Pointen gehen Erich Kästner über alles. Er produziere "wie ein Kaninchen", schreibt er gelegentlich an die Mutter; zum Glück sind es Pointen, vor denen er sich kaum retten kann. Pointe - das bedeutet Witz in jeder Form und mit allen Mitteln, eingeschlossen die Nähe zum Kabarett, zum Slapstick, zum Sketch, zum Kalauer, zur Abiturzeitung. Kästner, Schüler des Aufklärungshistorikers Albert Köster und selbst promovierter Kenner der Aufklärung, kann sich freilich auch noblere Vorbilder vorstellen. Im Vorwort zu einer Sammlung eigener Epigramme (1948/1950) erläutert er im Anschluss an Lessing den Bau eines Epigramms und damit zugleich die Konstruktionsformel für das eigene Verfahren. "Erwartung" wecken und überraschenden "Aufschluss" geben, im Zusammenspiel dieser Regeln können Pointen glücken.
Die Zeitungen, Wochenblätter, Magazine, für die der junge Kästner in Leipzig und Berlin schreibt, verlangen Tempo, Kürze und spannende Unterhaltung. Das Zeitmaß für die Lektüre ist die Zigarettenlänge, das Milieu für die Produktion das Kaffeehaus. "Ich gehe durch die Gärten der Gefühle, die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen", heißt es in Kästners "Kurzgefaßtem Lebenslauf". Doch gestatten die Zeitläufte solchen Leichtsinn? Mit sorgfältig geschliffenen Feindseligkeiten protestierte Walter Benjamin; es setzte (großbürgerliche) Klassenkampfkeile gegen die Späße einer (kleinbürgerlichen) Mittelschicht von Personalchefs, Angestellten und Vertretern, die selbst revolutionäre Motive an das Vergnügen verrieten, an Zerstreuung, Amüsement und Konsum. "Linke Melancholie" hieß im Jahr 1931 Benjamins Diagnose. "Gequälte Stupidität: das ist von den zweitausendjährigen Metamorphosen der Melancholie die letzte."
Ein neuer Band mit großenteils nicht gut bekannten Kästner-Texten gibt die Gelegenheit, die Haltbarkeit von Kästners Pointen zu überprüfen. Etwa 140 Erzählungen hat man inzwischen ausgemacht, elf davon hatte Kästner selbst für die Ausgabe letzter Hand (1969) ausgewählt, 42 präsentiert jetzt der neue Herausgeber Sven Hanuschek. Warum just und nur diese 42, wird freilich nicht verraten. Die meisten und besten sind jedenfalls in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu Hause, Kästners wohl produktivster Zeit.
Nicht gut bekommt ihm das Flair der fünfziger Jahre, als man versucht, wieder an internationale literarische Standards anzuknüpfen. "Paula vorm Haus", 1955 gedruckt, erzählt die Daphne-Geschichte einer Tochter, die im elterlichen Vorgarten zwischen den anderen Sträuchern und Bäumen aufwächst - und das ist schon alles. Viel Erwartung, Tiefsinn womöglich, aber kein Aufschluss, keine Pointe. Kästner wird seiner Begabung untreu. Das gilt auch für andere Versuche, die Nachkriegszeit einzufangen, sie wirken angestrengt, wollen belehren, haben gute Absichten ("Das Märchen von der Vernunft") und werden sperrig. Der Versuch des Herausgebers und Kommentators, mit intertextuellen "Überraschungen" aufzuwarten und gelegentlich sogar (für die Erzählung "Der Hungerkünstler") Kafka einzuschmuggeln, ist ebenfalls wenig erfolgreich.
Auch die wenigen Texte aus der Zeit nach 1933 lassen keine ,verdeckte Schreibweise' oder gar politisch Widerständiges erkennen. Nicht einmal die Bombardierungen Berlins können Kästner, der selbst ausgebombt wird ("Mama bringt die Wäsche", "Berliner Hetärengespräch 1943"), zu irgendeiner Form von Pathos hinreißen. Obwohl die neusachliche Attitüde mit den neuen Verhältnissen kaum noch zurechtkommt, bleibt sie die bevorzugte Äußerungsform (sofern davon nach dem Schreibverbot überhaupt noch die Rede sein konnte).
Den guten alten Kästner-Sound aber findet man nur vor 1933, als noch die alten Spielregeln gelten. Der urkomische "Sebastian ohne Pointe" macht sie schon im Titel kenntlich: hier geht es freilich nicht um den Mangel, sondern um ein Gedränge an Pointen, und das ist die Pointe. Für Tief- oder Parteisinn bleibt nirgends Raum. Allerdings will sich auch nicht jene Kälte einstellen, die man gern zum Hauptmerkmal der Neuen Sachlichkeit machen wollte. Die Kästnersche Sachlichkeit sucht vielmehr gemischte Gefühlslagen (ein Erbe der Lessing-Zeit); auch Tränen sind erlaubt, manchmal fließen sie reichlich. Dies geschieht regelmäßig, wenn Kinder im Spiel sind, vorzugsweise ein kleiner Junge mit seiner Mutter.
Gleich mehrfach hat Kästner ein autobiographisches Motiv - den Besuch des Schulzöglings bei seiner kranken Mutter - ausgeformt, als knappe Reminiszenz im "Fabian", als rührendes Erlebnis ("Ein kleiner Junge unterwegs"), als große tragische Schulgeschichte ("Die Kinderkaserne"), herzzerreißende Kinderszenen für Erwachsene. Kästners Verhältnis zu seiner Mutter und die "Muttchen"-Briefe, die er ihr schreibt, bilden den Hintergrund. Und nichts Rührenderes gibt es als die Geschichte des kleinen Mädchens, das am Grabe der verstorbenen Mutter von der neuen Mutter - an deren Hochzeitstag! - aus seiner Trauer herausgeholt wird ("Zwei Mütter und ein Kind").
Nein, Kästners Kurzgeschichten verfügen nicht über Härte und Schlagkraft amerikanischer Pendants. Dem steht schon der titelgebende "Herr aus Glas" im Weg. Er verkörpert einen Typus in Kästners Personal, nicht mehr den erotisch aktiven "möblierten Herrn" der Gedichte und des "Fabian", sondern den empfindsamen, verletzlichen Einzelgänger, manchmal ist er auch Dichter ("Der kleine Herr Stapf", "Ein Musterknabe", "Johann Baptist Krügel"). Der Schritt von der kurzen Geschichte zur Novelle, den die jäh in das sensible Leben einbrechende Erschütterung verlangt, ist freilich Kästners Sache nicht. Mit dem Vorbild Thomas Mann ("Der kleine Herr Friedemann") möchte er nicht konkurrieren, für Psychologie ist er zu ungeduldig.
Der einzige regelrecht autobiographisch aufgemachte Text gehört in diesen Umkreis, die "Briefe an mich selber" von 1940. Schon Fabian schickte Telegramme an sich selbst, um sich von seiner Wirtin wecken zu lassen; hier wird Dr. Kästner in eigener Sache zum Schreiber und Empfänger seiner Briefe. Er schildert sich selbst: "Ich weiß um Ihr empfindsames Gemüt, das Sie, in jahrzehntelangem Fleiß, mit einer Haut aus Härte und Kälte überzogen haben." Er kennt seine Kritiker: "Man hat Sie sogar gehaßt. Das hat Sie geschmerzt, aber nicht verwandelt." Kästner hat zugesehen, als die Nazis seine Bücher verbrannten. Sein größter Irrtum: Er wollte bessern. "Warst Du denn nur deshalb nicht Volksschullehrer geblieben, um es später erst recht zu werden?" Die Konklusion: "Wer die Menschen ändern will, der beginne nicht nur bei sich, sondern er höre auch bei sich selber damit auf!"
Wenn auch Tiefe, Kälte und Härte, politische Korrektheit und deftige Erotik in diesen Erzählungen vermisst werden mögen, überall bleibt Kästners Witz, wiegt alles auf und garantiert ein großes Lesevergnügen.
HANS-JÜRGEN SCHINGS
Erich Kästner: "Der Herr aus Glas". Erzählungen.
Herausgegeben von Sven Hanuschek. Atrium Verlag, Zürich 2015. 300 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main