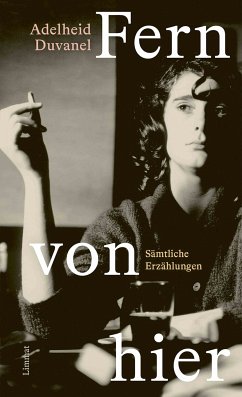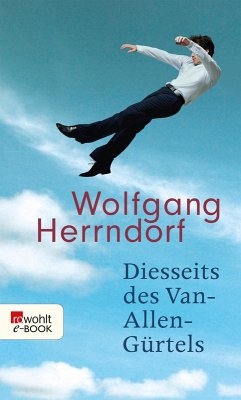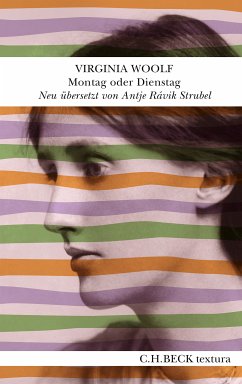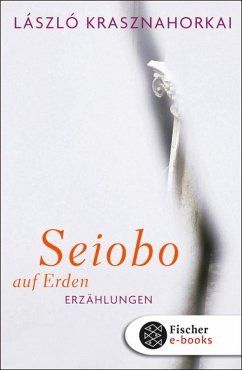Der hingestreckte Sommer (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Es gibt Geschichten, die sich unbemerkt, gewissermaßen undercover, im Gedächtnis festsetzen - oder solche, deren Strahlkraft uns wie ein Blitzschlag trifft: Auf einer Straßenkreuzung spielt sich in dem nicht enden wollenden »hingestreckten Sommer« die Begegnung mit einer Schlange ab. Ein Kind lernt das Lesen und sieht seinen Hund in ein jämmerliches Buchstabenbündel verwandelt. Johann Sebastian Bachs Augenhöhlen werden zum Gesprächsstoff Leipziger Gemeindemitglieder. Marlene Dietrichs Nachlass stellt sich als überraschend befremdlich heraus. Und die Tochter ist von Schneeengeln genau...
Es gibt Geschichten, die sich unbemerkt, gewissermaßen undercover, im Gedächtnis festsetzen - oder solche, deren Strahlkraft uns wie ein Blitzschlag trifft: Auf einer Straßenkreuzung spielt sich in dem nicht enden wollenden »hingestreckten Sommer« die Begegnung mit einer Schlange ab. Ein Kind lernt das Lesen und sieht seinen Hund in ein jämmerliches Buchstabenbündel verwandelt. Johann Sebastian Bachs Augenhöhlen werden zum Gesprächsstoff Leipziger Gemeindemitglieder. Marlene Dietrichs Nachlass stellt sich als überraschend befremdlich heraus. Und die Tochter ist von Schneeengeln genauso fasziniert wie vom Vater, der eine Apfelsine so in Schiffchen schneidet, als wäre es ein Zauberstück. In ihren Prosatexten erzählt Gisela von Wysocki berückende Geschichten und erweckt biographische Einschläge zu neuem Leben. Ihnen bereitet sie eine Bühne: Fundstücke, unerwartete Wendungen und Ereignisse treten hervor, werden aufrüttelnde Gegenwart. Denn: »Alles dies lebt, hat seine Wirklichkeit, greift über auf uns, die wir nach Worten suchen.«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.